16-11-2003
EINE FRAU IN BERLIN
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Dokument erstellt am 10.04.2003 um 16:32:01 Uhr
Erscheinungsdatum 11.04.2003
Zusammenrücken in fremden Kellern
Vom Leben in einer befreiten, besetzten Stadt: Tagebücher einer Frau aus Berlin, April bis Juni 1945
Von
Angela Gutzeit![]()
|
April/Mai 1945: Die russische Armee rückte in Berlin ein, lieferte sich letzte
Gefechte mit ein paar versprengten deutschen Flakhelfern und Soldaten und
übernahm schließlich die im Kriegschaos versinkende Millionenstadt als Sieger.
Hunger und Vergewaltigungen folgten. Immer wieder diese beiden Worte in den
späteren Erzählungen: Hunger und Vergewaltigungen. In den Schilderungen der
betroffenen Frauen gerannen sie zu Synonymen für die Kriegsleiden schlechthin.
Für die Nachgeborenen waren das nichts als Reizworte, Ausdruck des
Selbstmitleids, das die Leiden der Opfer des Naziregimes aus dem Bewusstsein
verdrängte bis zur blanken Empfindungslosigkeit. Wer weiß, ob dieses Buch einer
anonymen Tagebuchschreiberin, wäre es früher erschienen, an der
Dialogunfähigkeit auf beiden Seiten etwas geändert hätte. Diese Aufzeichnungen
einer Berliner Frau, die als Autorin anonym bleiben wollte, bieten eine
ungewöhnliche Sicht auf die damaligen Ereignisse, die in dieser Qualität in den
meisten familiären Erinnerungsberichten fehlte. Aber die ungeheuren Verbrechen
des Naziregimes verstellten über Jahrzehnte hinweg den Weg zu einer offenen und
ehrlichen Auseinandersetzung mit den Kriegsfolgen für die deutsche Bevölkerung. |
|
Am 22. April 1945 notiert sie: "Flak und Artillerie setzen die Akzente über
unseren Tag. Manchmal wünsche ich, es wäre schon alles vorbei. Sonderbare Zeit.
Man erlebt Geschichte aus erster Hand, Dinge, von denen später zu singen und zu
sagen sein wird. Doch in der Nähe lösen sie sich in Bürden und Ängste auf.
Geschichte ist sehr lästig." Es geht hier also nicht einfach nur um private
Notizen. Und deshalb fallen hier auch kaum Worte über das Schicksal ihrer
Familie oder ihres Freundes. Umso mehr ist sich die Verfasserin dieser Zeilen
ihrer Chronistentätigkeit und der besonderen historischen Situation zwischen
Kriegsende und Neuanfang voll bewusst.
Massengefühle, so schreibt sie, seien ihr immer zuwider gewesen, und das
befähigt sie dann auch wohl zur distanzierten Beobachterin. Andererseits will
sie sich aber bewusst "dem Massenmenschlichen hingeben, will es miterleben, will
dran teilhaben". Und genau diese Perspektive des kritischen Blicks inmitten des
Gewühls beim Plündern eines Vorratslagers, beim Zusammendrängen mit oft fremden
Menschen in Kellern und halb zerstörten Wohnungen oder bei der Zwangsarbeit im
Dienst der russischen Armee, diese Perspektive lässt das Zeitgeschehen und deren
Menschen plastisch hervortreten.
Die Autorin beschreibt schonungslos die Vergewaltigungen durch russische
Soldaten, auch die zahlreichen Übergriffe auf sie selbst. Bei diesen
Erfahrungen, das weiß sie genau, geht es nicht selten ums Überleben, nicht so
sehr im physischen, sicher aber im psychischen Sinn. Völlig unsentimental
beschreibt sie, wie sie es schafft, die wilden sexuellen Übergriffe durch eine
gewisse geregelte und damit schutzbietende Struktur zu ersetzen. Sie sucht sich
gezielt nacheinander höherrangige russische Soldaten, denen sie
Geschlechtsverkehr anbietet, um sich die Horden vom Leibe zu halten. Dazwischen
ist sie noch in der Lage zu schreiben und mit den Russen so weit wie es geht
Gespräche zu führen, sich über deren Kinderliebe und - trotz des Missbrauchs -
deren Bewunderung für gebildete Frauen Gedanken zu machen.
Der Schriftsteller Kurt W. Marek schreibt in seinem Nachwort zu diesem Buch,
dass ihn die Kälte der Autorin in diesen Aufzeichnungen am meisten erschüttert
habe, eine Kälte, die er auf die vor Entsetzen gefrorenen Empfindungen der
Tagebuchschreiberin zurückführt. Doch träfe diese Charakterisierung den Kern,
wäre das Buch nur halb so interessant. Sicher, die Verfasserin dieser bewegenden
Zeilen fragt sich selbst, ob sie jemals wieder zu echter Liebe fähig sein werde,
ob sie nicht zur empfindungslosen "Dirne" herabgesunken sei, ob sie nach all
diesen Erlebnissen in der Lage wäre, je wieder einen Platz in einem normalen
Leben zu finden. Das deutet auf Abstumpfung hin. Aber Kälte spricht nicht aus
diesen Zeilen, sondern ein hohes Reflexionsvermögen.
Die Autorin beherrschte ein wenig die russische Sprache. Sie hatte das Land der
Sieger früher einmal bereist. Sie hatte sich kaum von der Nazipropaganda
beeindrucken lassen, die Russen als Untermenschen titulierte, obwohl sie selbst
an einer Stelle auch einmal von einer niederen Entwicklungstufe der Russen
spricht. Und sie hat mit wachem Verstand die ersten gesicherten Meldungen über
das Geschehen in den Konzentrationslagern wie auch über das Wüten der Deutschen
Wehrmacht in Osteuropa aufgenommen. Das alles führt sie zu einem in ihrer Lage
unglaublich bemerkenswerten Gedanken, nämlich dem von der "ausgleichenden
Gerechtigkeit" - so sehr man die Legitimität dieser Überlegung auch bezweifeln
kann und muss.
Nein, das Buch Eine Frau in Berlin strahlt nicht Kälte aus, wenn, dann
eher Entsetzen, aber zuallererst Intelligenz und Feinfühligkeit bei der
Beurteilung von Freund und Feind. Außerdem versteht sie es, ihr Leiden als
Kollektiverlebnis, genauso aber auch ihren nüchternen Realitätssinn als
spezielle Qualität vieler Frauen in Kriegszeiten einzuordnen. Dies ist ein
außerordentlich beeindruckendes Dokument, das die Andere Bibliothek des Eichborn
Verlages nun ihren anderen, verwandten Publikationen hinzufügen kann wie zum
Beispiel Magret Bovaris Tage des Überlebens, Friedrich Recks Tagebuch
eines Verzweifelten oder dem Band Europa in Trümmern. Augenzeugenberichte
aus den Jahren 1944 bis 1948.
WORLD PRESS REVIEW
ONLINE
From the July 2003 issue of World Press Review (VOL. 50, No. 7)
Hanna Leitgeb, Literaturen (monthly literary magazine), Berlin, Germany, May 2003
The victors were not picky
when it came to claiming their booty. The Russian soldiers spared scarcely a
single woman when they conquered Eastern Germany and Berlin in the spring of
1945—carrying out systematic mass rapes in order to humiliate the aggressors,
finally at their mercy. Historians, sociologists, and psychologists have all
dealt with this kind of war crime and the lasting trauma it engenders; they have
argued about it and analyzed it. But, at the same time, given the overshadowing
balance of work on German guilt, their studies have always had a rather marginal
character.
Now Eichborn Verlag, in its series Die Andere Bibliothek (The Other Library), is
making a unique document available once again, one that should attract a wide
audience. Given the recent discussions of Germans as victims of the bombing
campaign, it has a good chance of achieving the success it deserves. The book,
Eine Frau in Berlin (A Woman in Berlin), is a collection of diary entries
by an anonymous woman in her early 30s who narrates the events of her life in
the last years of World War II and the first postwar years in bombed-out Berlin.
Her manuscript—obviously the work of a highly educated woman with good
connections to the Berlin publishing community—was initially circulated among a
circle of friends, until one of them recognized its value.
Kurt W. Marek, the author of the bestseller Gods,
Graves, and Scholars
[under the pseudonym Ceram], was one of those friends. He realized its
documentary importance and arranged for its publication. It first appeared in
1954 in New York in translation and then in 1955 in nine additional languages.
But it was not until 1959 that the author finally consented to a German-language
edition. The German edition seems to have had little impact: In any case, there
is no real evidence that it was reviewed and read.
It is easy to imagine that the content of this diary of postwar society was too
frank, too extreme, and too unsentimental for readers, in the face of the
atmosphere of collective silence about the past and the determinedly stoic
look-forward-not-back attitude pervasive during reconstruction.
Today, after the end of the Cold War and the old Federal Republic of Germany,
the debate over the past is more open to hearing about Germans as victims—without
engendering accusations of revanchism. Günter Grass’ novel Crabwalk and
Jörg Friedrich’s book Der Brand on the bombing war are only the most
prominent examples of this trend.
These anonymous extracts from a diary enlarge upon this literature by providing
a decidedly female perspective, but one in which the writer never runs any
danger of falling into the typical clichés about the fate of womankind. The
writer is too reflective, too candid, too worldly for that. For women to keep
diaries in the last days of the war, as the front drew closer, was not uncommon—what
is exceptional and impressive about this book is that the author, even as she
was being treated as booty, was able to see herself as part of history and come
to independent judgments about her experiences. What befell her as a woman
served to provide her with an eye to consider larger questions of morality and
societal mechanisms—within and beyond the exceptional circumstances of the war
and the Third Reich.
“My center is, as I write this, my belly. All my thoughts, feelings, desires and
hopes begin with food.” The diarist insists that all her energy was devoted to
organizing her survival amid the everyday life of wartime: standing in line when
rations were distributed, stealing from other people’s homes and gardens,
looting abandoned shops and warehouses, getting water—day after day, bucket
after bucket—from the pump.
In the final months of the war, the writer—bombed out of her own home—moved into
a high-rise apartment in an eastern part of Berlin belonging to a colleague
called up to military service. But the heavy bombing attacks forced her and her
neighbors to spend most of their time on the ground floor or in the basement.
She reports laconically on the idiosyncrasies that develop in such situations
and the new hierarchies that arise. “We were no longer governed. And yet, there
was still some kind of order here, a system, in every basement. Mankind must
have had something like this back in the Stone Age. Herd instincts,
species-specific behaviors.”
Terrified by German propaganda, these “cave-dwellers” awaited their Russian
conquerors in a state of panic. The fear of being raped was in the air.
“Sometimes I wish it were already over. Exceptional times. People experience
history first hand. Things that will later be sung about, told about. But, up
close, they are merely burdens and fears. History is hard to endure.”
From German men, the women expected no protection—they seemed to be too
shattered, and in need of defense themselves. They were losers, deserters,
former officials. “They made us sorry, they looked so puny and weak, the weaker
sex....The male-ruled world of the Nazis, with its cult of the strong man, was
crumbling—and with it the myth of the ‘man.’ ” With an incredible feeling for
the constructs of societal roles, the diarist depicted the alienation of women
from men in a disintegrating society—a process that had begun before the enemy
arrived, and which was intensified by the sexual violence that ensued.
On the night of April 27-28, catastrophe arrived for the people in the basement.
The Russians came, and asserted their right as victors. The author was raped
several times by the occupiers on this first night alone, and she was no
exception. As a rule, the German men did not defend the women. The diarist noted
an arrangement for survival: “No man lost face because he betrayed a woman—the
neighbor’s wife, or his own—to the victors. To the contrary, he would be
disliked if he made the Russians angry. Even so, the indelible shame remained.”
Which the author, with her vital pragmatism, immediately dismissed. “I laugh
right in the middle of all this awfulness. What should I do? After all, I am
alive, everything will pass!” And soon enough she developed a strategy to keep
the worst of the men away from her, making use of her knowledge of Russian,
acquired during her many trips around Europe as a college student. She looked
around and found the highest-ranking officer in the neighborhood and made
herself available to him, in hopes of getting some of his rations in return. The
deal was called “sleeping for food.” Everyone was aware of the slippery slope
leading to prostitution; it eroded her pride, made her physically ill. But
morality was a major luxury in those days and gallows humor the only way to
process such events.
The analytical acuity with which the diarist was able to understand her
situation, coupled with a gift for irony and a worldly and self-conscious lust
for life, con-stantly astonish the reader. The author is clear about her own
robustness of character. Many times she depicts violations of other women so
terrible as to be unspeakable, reflects upon the fact that more fragile women
could be destroyed by such acts, and hopes—in vain—that the collective trauma of
the rapes may be possible to overcome collectively, too.
She relies upon a subjective capability to sublimate her suffering, to see
herself as part of a mass, which is one reason she insists upon her anonymity.
She writes again and again of “we Germans,” and “the bitter defeat.” She
remained in Germany, although she had opportunities to leave, and recognizes
that she feels tied to the country, above all, culturally, and despite its
government. “I read Rilke, Goethe, Hauptmann. It consoles me that they are part
of us, and people like ourselves.” She is not really interested in politics in
the narrow sense of the word, but at the same time has too sensitive a feeling
for the truth not to discover her own share of guilt, and to be disgusted by the
sanctimoniousness of her fellow Germans. “Everyone now is turning their backs on
Adolf, and no one was ever a supporter. Everyone was persecuted, and no one ever
turned anyone else in. Was I myself a supporter, or in the opposition? I was, in
any case, here, and breathed in the same air, the air that surrounded us and
affected us, even if we did not want that.”
In reading these entries, it is clearer than ever that the Nazi era cannot be
satisfactorily understood using the current victim/perpetrator schema. The times
were entirely too complex to be reduced to such categories. The diary offers us
a perspective on how a modern bourgeois society can be deformed when put under
unimaginable stress. It brings us face to face with how moral standards can
vanish in the face of extreme violence, how the corset of civilization can burst
open and people can become numb beasts, bent only upon power and survival.
The book is no tale of resistance, no report from either a Nazi fellow traveler
or a tale of victims or perpetrators, but something else—a portrait of German
life amid all that. We have the diaries of Anne Frank and Victor Klemperer and
the observations of Sebastian Haffner. Now we have the entries written by an
anonymous woman, which enlarge this canon by adding an important voice.
Because of her capacity for reflection, this woman finds it impossible to
develop hatred for the occupation forces. “I hate the feeling that something
happened to me that balanced an account.” When the defeated Germans, in the
early days of peace, were given technology back as electric power was restored,
they heard the first reports about the concentration camps on the radio. “I
leafed through a volume of Aeschylus plays, and discovered The Persians.
With its cries of the vanquished it seemed to fit our situation, yet it did not.
Our German misfortune has aspects of horror, sickness, and insanity; it is not
comparable to anything in history. Then came another radio report on the camps.
The most terrible thing about all this is the orderly and thrifty nature of it
all: Millions of people turned into fertilizer, mattress-stuffing, soap, and
felt—Aeschylus never saw anything like this.”
Her incredible sensitivity to language, her unpretentious use of her education,
her gift for precise observation, her intellectual acuity, her clear judgment—one
should never stop praising this book, never stop urging others to read it. It is
the unique testimony of a victim of violence who maintains her integrity and a
consciousness of her historical situation. In its humanity and maturity it is a
shocking yet constructive document of horror and shame, of the will to survive.
The German reality of the Third Reich has been illuminated by a new light.
![]()
10-6-2003
ANONYMA: Eine Frau in Berlin. Tagebuch-Aufzeichnungen vom 20. April bis zum 22. Juni 1945. Mit einem Nachwort von Kurt W. Marek. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 291 Seiten, 27,50 Euro.
Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes
Im Frühjahr der Befreiung: Das Berliner Tagebuch einer Unbekannten erzählt von Hunger und Vergewaltigungen
So kamen die Russen, die Befreier, zu den Bewohnern Berlins: „breite Rücken, Lederjacken, hohe Lederstiefel ... pralle Breitschädel, kurzgeschoren, wohlgenährt, unbekümmert“. So hat eine Frau, Anfang dreißig, sie am Freitag, den 27. April 1945, gesehen. Als sie am folgenden Samstag daran geht, ihre Erlebnisse zu notieren, ist sie von mehreren Sowjetsoldaten vergewaltigt worden. Die Schlagzeilen des „Völkischen Beobachters“ hatten die Angst davor systematisch geschürt, Schändungen waren Kellergespräch: „Allerlei Geschichten kursieren. Frau W. ruft: ,Lieber ein Russki auf’m Bauch als ein Ami auf’m Kopf.‘ Ein Witz, der schlecht zu ihrem Trauerkrepp paßt. Fräulein Behn kräht durch den Keller: ,Nu woll’n wir doch mal ehrlich sein – Jungfern sind wir wohl alle nicht mehr‘. Sie bekommt keine Antwort.“
Das Tagebuch der jungen Frau, das jetzt in der „Anderen Bibliothek“ wieder aufgelegt worden ist, gehört zu den merkwürdigsten Dokumenten der Nachkriegszeit. Es beginnt am letzten Geburtstag des Führers, „an dem Tag, als Berlin zum ersten Mal der Schlacht ins Auge sah“ und endet am 22. Juni 1945. Hellsichtiger, konzentrierter, intelligenter als hier sind die ersten Wochen des Kriegsendes wohl nirgends beschrieben worden, und doch umgibt eine Aura der Ungewissheit dieses Tagebuch. Die Autorin ist unbekannt, die Textgeschichte nur lückenhaft dokumentiert, das Geschehen im Berliner Irgendwo lokalisiert.
Bitte mit Führungszeugnis
Als „bloß privates Gekritzel, damit ich was zu tun habe“, hat die junge Frau ihr Tagebuch gegenüber neugierigen Fragen im Luftschutzkeller verteidigt. Drei dicht beschriebene Schulhefte mit eingelegten Zetteln sind daraus geworden. Im Juli 1945 begann sie, ihre Aufzeichnungen mit der Schreibmaschine zu tippen, auszuformulieren. Nach Auskunft des Vorworts, von dem nicht verraten wird, wer es verfasste, „entstanden auf grauem Kriegspapier 121 engzeilige Maschinenseiten“. Dieses Manuskript kam auch in die Hände des Schriftstellers Kurt W. Marek, eines Bekannten der Schreiberin. Er nahm sich des Textes an und sorgte für eine Ausgabe in den USA.
Das muss verwundern, schließlich verfügt Kurt W. Marek über glänzende Kontakte zur deutschen Verlagswelt. Als freier Kritiker hatte er seine Karriere 1932 begonnen, schrieb im Dritten Reich für die „Koralle“ und die „Berliner Illustrierte Zeitung“. 1938 zur Wehrmacht eingezogen, war er Kriegsberichterstatter an der Ostfront, in Norwegen und Italien, wurde bei Monte Cassino verwundet, kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach Kriegsende wurde er Redakteur der Welt und Cheflektor des Rowohlt- Verlages. 1949 erschien unter dem Decknamen C. W. Ceram sein Sachbuch- Bestseller „Götter, Gräber und Gelehrte“. Hauptsächlich wohl aus steuerlichen Gründen übersiedelte Marek in die USA, wo 1954 auch „A Woman in Berlin“ erstmals erschien, mit einem Nachwort Cerams versehen.
Übersetzungen ins Schwedische, Norwegische, Holländische, Dänische, Italienische, Ausgaben in Japan, Spanien, Frankreich und Finnland folgten. Die erste deutsche Ausgabe kam 1959 bei Helmut Kossodo (Genf und Frankfurt am Main) heraus und fiel durch. Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wollte man diese Tagebuch-Aufzeichnungen nicht lesen.
Der Text, den der heutige Leser in seinen Händen hält, ist mehrfach überarbeitet worden. Es handelt sich keineswegs um Kritzeleien, niedergeschrieben in der Not des Augenblicks, sondern um einen gekonnt komponierten, um spätere Reflexionen ergänzten Bericht. Verändert hat ihn die Autorin, als sie 1945 ihr Tagebuch für einen Freund abschrieb, verändert wurden für die Buchausgabe „sämtliche Namen und zahlreiche Details“. Das Manuskript liegt heute bei der Witwe Kurt W. Mareks. Die Autorin, die unerkannt bleiben wollte, hat ihn vor ihrem Tode noch einmal durchgesehen. Dieses korrigierte Manuskript war die Textgrundlage für die Neuausgabe in der „Anderen Bibliothek“, in der die doch ausschlaggebende Textgeschichte höchst beiläufig behandelt wird.
Die gebildete, äußerst sprachbegabte Autorin, hatte wohl gute Kontakte zur Berliner Verlags- und Zeitungswelt. Viele Länder Europas hat sie bereist, darunter auch den europäischen Teil der Sowjetunion, sie kannte Moskau unter Stalin, und sie sprach russisch. Das hebt ihren Bericht heraus. Die Fahrräder und Uhren stehlenden, Lebensmittel verteilenden, vergewaltigenden Sowjetsoldaten erscheinen hier nicht allein als Männer, die aus dem Dunkel auftauchen und „Frau komm!“ rufen. Sie haben Namen und Biographien: Petka, Anatol, Andrej, ein weißblonder Leutnant, ein Major. Mit der gleichbleibend kalter Aufmerksamkeit werden das Verhalten der Deutschen und das Treiben der Sieger charakterisiert.
Als ein Matrose die Verfasserin bitte, ihm ein sauberes, ordentliches Mädchen zu besorgen, notiert sie: „Das ist denn doch die Höhe. Jetzt fordern sie von ihren besiegten Lustobjekten bereits Sauberkeit und Bravheit und einen edlen Charakter! Fehlt bloß noch ein polizeiliches Führungszeugnis, ehe man sich für sie hinlegen darf!“ Über eine Likörfabrikantin, hinter der die Russen ihrer Leibesfülle wegen oft hinterher waren, schreibt sie: „Die Likörfabrikantin freilich hat keine Not gelitten. Sie hat den ganzen Krieg hindurch was zum Tauschen gehabt. Nun muß sie ihr ungerechtes Fett bezahlen.“ Für die fünfziger Jahre, in denen man gern verschwiemelt-tiefsinnig über Krieg und Nationalsozialismus sprach, war das wohl zu deutlich.
Etwa 110 000 von den 1,4 Millionen Frauen Berlins sind nach Schätzungen – genaue Untersuchungen fehlen immer noch – zwischen Frühsommer und Herbst 1945 vergewaltigt worden. Rasche Abtreibungen hatten die Nationalsozialisten noch geplant, „um unerwünschten mongolischen und slawischen Nachwuchs zu verhindern“. Glauben wir dem anonymen Bericht, hätte allein durch Vernichtung der Alkoholvorräte viel Gewalt verhindert werden können.
„Trotz zahlreicher Befehle, in denen die Beschlagnahme verschiedener lebenswichtiger Ausstattung der Bevölkerung, die Durchführung eigenmächtiger Hausdurchsuchungen, Gewalttätigkeit und Vergewaltigungen sowie andere Willkürakte kategorisch verboten wurden, führen einzelne Armeeangehörige dieses schändliche Verhalten bis heute fort“, beginnt der Befehl Nr. 180, den der erste Berliner Stadtkommandant, Nikolai Bersarin, als Oberkommandierender der 5. Stoßarmee am 7. Mai zur „Organisation des Patrouillendienstes“ erließ. Aber selbst drakonische Strafen setzten der von vielen Kommandeuren geduldeten oder ermutigten Gewaltorgie kein Ende.
Feste Verkehrsformen
Anfang Mai hatten sich schon feste Verkehrsformen herausgebildet. Um nicht zum Opfer eines jeden zu werden, hatte sich die junge Frau einen Major als Beschützer zugelegt, der sie mit Lebensmitteln versorgte. „Er sang wieder, leise, melodisch, ich höre es gern. Er ist redlich, reinen Wesens, aufgeschlossen. Aber fern und fremd und so unausgebacken. Wir sind Westler alt und überklug – und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln.“
Das Tagebuch endet, als Gerd, der geliebte Freund der Verfasserin, von der Front kommt und sie ihm ihre Aufzeichnungen zu lesen gibt. Er will nicht wissen, was geschehen ist, stößt sich an der „Schamlosigkeit“, flieht ins Schweigen – und nimmt damit individuell die Jahrzehnte kollektiven Beschweigens vorweg. Dies hatte selbstverständlich auch politische Gründe, schließlich waren Vergewaltigungen und Plünderungen ein Lieblingsthema der verbohrten Rechten, die durch Aufrechnung den NS-Terror rechtfertigen wollte. Dass wenig über die tatsächlichen Erfahrungen der ersten Friedenstage gesprochen wurde, dürfte aber mindestens ebenso an der kläglichen Rolle liegen, die deutsche Männer dabei spielten. „In der Pumpenschlange erzählte eine Frau, wie in ihrem Keller ein Nachbar ihr zugerufen habe, als die Iwans an ihr zerrten: ,Nu gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!‘ Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes.“
Wie darüber vernünftig zu reden wäre, kann man an diesem Bericht lernen: mitleidlos gegenüber Kollektiven und Gruppen, aufmerksam auf Hilfskonstruktionen und Lügen, mit denen einzelne ihr Durchwursteln rechtfertigen, genau in der Dokumentation individuellen Leids. Es wäre zu wünschen, dass eines Tages eine textkritische Ausgabe dieser einzigartigen Tagebuch-Aufzeichnungen erscheint.
Wie darüber vernünftig zu reden wäre, kann man an diesem Bericht lernen: mitleidlos gegenüber Kollektiven und Gruppen, aufmerksam auf Hilfskonstruktionen und Lügen, mit denen einzelne ihr Durchwursteln rechtfertigen, genau in der Dokumentation individuellen Leids. Es wäre zu wünschen, dass eines Tages eine textkritische Ausgabe dieser einzigartigen Tagebuch-Aufzeichnungen erscheint.
JENS BISKY
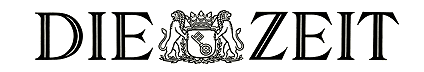
5-6-2003 N.º 24
Anonyma: Eine Frau in Berlin
Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945; mit einem Nachwort von Kurt W. Marek; Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003; 300 S., 27,50 ¤
Tagebuch
Eilige Notizen eines Höhlenmenschen
Zeit: April 1945. Ort: Berlin. Eine Frau schrieb auf, was passierte, als die Russen kamen
Es beginnt am 20. April 1945 mit Angst und mit Hunger. Dieser Tag ist Führers letzter Geburtstag, „ein Datum, an das die meisten überhaupt nicht mehr gedacht hatten“. Die Bevölkerung von Berlin verbringt den größten Teil der Zeit im Keller.
Eine Frau versucht zu lesen und bleibt an einer Passage des Buches hängen, in der jemand vor Verliebtheit eine Mahlzeit stehen lässt. Darüber kommt sie nicht hinweg. „Offenbar setzt ein verfeinertes, wählerisches Liebesleben regelmäßige, ausreichende Mahlzeiten voraus“, notiert sie um 16Uhr in ein Heft, das sie in einer fremden Wohnung gefunden hat, in der sie als Ausgebombte untergekommen ist. „Alles Denken, Fühlen, Wünschen und Hoffen beginnt beim Essen.“
Von solcher Art sind die Überlegungen, Beobachtungen und Notizen, die diese bis heute namenlos gebliebene Frau bis Mitte Juni 1945 in drei Hefte und auf lose Zettel kritzelt. Bomben, Essen, Wetter, Kellergespräche, Vergewaltigungen und Schlangestehen: Alltäglichkeiten das alles, ein großes Durcheinander, das ungefiltert auf den Seiten des Tagebuchs landet. Es ist kein Versuch der Beschönigung zu entdecken, nur der Versuch, zu verstehen, was geschieht. Hastig, oft in Kurzschrift und mit vielen Abkürzungen schreibt sie, im Keller, in den kurzen Verschnaufpausen zwischen zwei Bombenangriffen an einem Tisch, nach den Russenbesuchen und Arbeitseinsätzen: „Ich schreibe, es tut gut, lenkt mich ab. Und Gerd soll es lesen, wenn er wiederkommt.“ Gerd wird sagen, als er tatsächlich wiederkommt, dass er die Abkürzungen nicht versteht – wie „Schdg“. Und als er verstanden hat, Schdg. für Schändung, wird er nichts mehr sagen und gehen. Sie hat diese Reaktion geahnt: „Wir … werden fein den Mund halten müssen, werden so tun müssen, als habe es uns, gerade uns ausgespart.“
Der Tagebuchtext der Anonyma kursierte schon einmal, Ende der achtziger Jahre, in West-Berlin – als ein Bündel von Fotokopien der ersten deutschsprachigen Ausgabe, die 1959 beim Schweizer Kossodo Verlag erschienen war. Die private Rückseite der Geschichte des Zweiten Weltkriegs war allerdings in den fünfziger Jahren kein großes Thema; es interessierte nur diejenigen, die sich an der politisch korrekten Sichtweise auf eine Befreiung stießen, die doch auch Rache des Sieger gewesen war (Befreier und Befreite heißt der Film, den Helke Sander dazu drehte). Für die Generation der Kriegskinder bedeutete es, sich mit der eigenen Biografie auseinander zu setzen: gezeugt von Wehrmachtsoldaten (oder, oft gehütetes Geheimnis, Besatzern), aufgezogen von Trümmerfrauen; war es eine Generation mit vielen Waisen, Halbwaisen, mit Kindern von unbekannten Vätern und Müttern wider Willen. Die Generation der 68er, die nicht selten den Vätern die Schuld an allem gab – und dem Schweigen der Mütter.
Die fotokopierten Blätter der Frau in Berlin waren dann in den Achtzigern eine kleine Sensation, wenn auch eine unbequeme. Erst heute scheint mit der erneuten Veröffentlichung in der Anderen Bibliothek beim Frankfurter Eichborn Verlag die Zeit reif für die Ehrlichkeit und Schonungslosigkeit dieses Textes. C. W. Ceram (alias Kurt Marek, Verfasser des Sachbuch-Klassikers Götter, Gräber und Gelehrte), der auch an der Erstveröffentlichung in den USA beteiligt war und das Nachwort zur deutschen Fassung schrieb, benutzt die Vokabel „schamlos“.
Die Frau in Berlin schämt sich tatsächlich nicht. Nicht auf diesen Seiten. Später mag sie sich geschämt haben: als die Restauration der fünfziger Jahre mit weitgehendem Erfolg die Hierarchie der Geschlechter wiederherstellte und das Moralkorsett das Zerbrochene eisern zusammenhielt; als Frauen das, was man ein „Vorleben“ nannte, nicht gehabt haben sollten. Die langjährige Weigerung der Autorin, der Veröffentlichung ihres Tagebuchs überhaupt (und später der deutschen Wiederöffentlichung) zuzustimmen, sprechen dafür. Dabei wäre es gut gewesen, schon früher einiges gewusst und Sätze gelesen zu haben wie diesen über die Mitschuld aller Deutschen: „War ich selbst dafür? Dagegen? Ich war jedenfalls mittendrin und habe die Luft eingeatmet, die uns umgab und die uns färbte, auch wenn wir es nicht wollten.“
Sie brauchte das Schreiben für ihr Gleichgewicht
Von der Anonyma weiß man so viel, dass sie es mit Journalismus zu tun hat, als Fotografin und Zeichnerin; dass sie mehrere Sprachen spricht, darunter Russisch. Der Stil des Tagebuchs zeigt sie als nicht unerfahrene Schreiberin – und als Person, die gewohnt ist, sich mit der Realität frontal auseinander zu setzen. Andererseits brauchte sie damals in jenen schrecklichen Frühjahrstagen des Jahres 1945 auch das Schreiben, um ihr Gleichgewicht zu halten, während alles ins Rutschen geriet: die Nazi-Ordnung, die bislang eisern gegolten hatte, der letzte Rest von bürgerlicher Sicherheit, die Grenzen des Erlaubten und der Konvention, die zwischenmenschliche Distanz und die Moral sowieso. Alle plünderten, alle stahlen, auch voneinander. Die „gewohnte Umwelt von Sippe, Nachbarschaft, polierten Möbeln und stundenfüllenden Tätigkeiten“ löste sich auf; stattdessen bildeten sich Notgemeinschaften zur Nahrungsbeschaffung, zum Plündern, Sichern. „Höhlenmenschen“, notiert die Tagebuchschreiberin und beobachtet sich selbst und ihre Nachbarn bei der Metamorphose. Vom „Moralkorsett“ blieben nur Fragmente: Während schon die Kugeln über die Straße pfiffen und Granaten in die Warteschlangen einschlugen, gaben sie im Laden, beim Verkauf der letzten Bestände auf Lebensmittelkarten, noch auf Heller und Pfennig heraus.
Es gilt nur noch die Rangordnung der Männer
Dann sind „die Russen“ da. Für die Autorin, für alle Frauen beginnt nun die Erfahrung, Beute zu sein, ohne Ansehen von Person, Bildung, Herkunft oder politischer Einstellung – oder Willen. „Unsere“, sagen die Frauen in der Schlange an der Wasserpumpe mit bemerkenswerter Objektivität, „werden es drüben nicht viel anders gemacht haben.“
Es ist wohl das Schreiben, der Rückzug auf einen Beobachtungsposten, der ihr die nötige Distanz zum Überleben verschafft – in der Reserve größtmöglicher Rationalität, wo Gefühle und moralische Erwägungen nicht zugelassen sind. „Erstarrung. Nicht Ekel, bloß Kälte. Das Rückgrat gefriert, eisige Schwindel kreisen um den Hinterkopf. Ich fühle mich gleiten und fallen, tief, durch die Kissen und Dielen hindurch. In den Boden versinken – so ist das also.“ Und so fasst diese Frau den pragmatischen, aus der völligen Desillusionierung geborenen Entschluss: „Hier muss ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leib hält. Offizier, so hoch es geht, Kommandant, General, was ich kriegen kann.“ Die Rechnung geht auf, fast. Dafür gibt es relative Sicherheit, Essen, Alkohol, sogar Zigarren. Die Grenzen zwischen Vergewaltigung und Prostitution erweisen sich als fließend.
Diese Mechanismen, und das ist das eigentlich Schockierende an diesem Tagebuch, erinnern an die feministische Analyse zwischengeschlechtlicher Ausbeutungsverhältnisse. In der archaischen Situation, in der den Soldaten keine höhere Instanz die Beute Frau streitig macht, gilt nur die Rangordnung der Männer. Die Tagebuchschreiberin sieht dies mit aller Klarheit; und doch differenziert sie unter den Männern, die als Sieger, als Feinde, als Rächer durch Keller und Wohnungen ziehen: Sie zeichnet sie als Individuen, unterscheidet die verhinderten Romeos, die wirklichen Frauenhasser, die Wilden – sogar Unterwürfige sind dabei; und sie schätzt die Gebildeten mit ihren ausgeprägten Umgangsformen. Anschaulich berichtet sie von der Zerteilung eines Herings auf polierter Tischplatte und von den politischen Gesprächen, bis hin zu dem unter den Frauen üblich gewordenen „Schändungshumor“.
Sie schildert in kühlen Worten Selbstmorde und die Verzweiflung derer, die in der Erniedrigung weiterleben: „So viel Liebe, so viel Aufwand mit Häubchen, Badethermometern und Abendgebet“, heißt es im bitteren Rückblick auf die Kindheit, „für den Unflat, der ich jetzt bin.“
Es dauerte bis zum 8. Mai. Dann verschwinden die Russen aus den Nachbarwohnungen, von der Straße. Am Nachmittag des 8. Mai 1945, des „historischen Augenblicks“ par excellence, kniete sich eine junge Frau in Berlin, ungewaschen, erniedrigt, aber lebend, auf den Boden und kämmte die von Russenstiefeln gezausten Teppichfransen gerade.
„Zum ersten Mal seit langem hörte ich deutsche Männer laut sprechen, sah sie sich energisch bewegen. Sie wirkten geradezu männlich – oder doch so wie das, was man früher mit dem Wort männlich zu bezeichnen pflegte. Jetzt müssen wir nach einem neuen, besseren Wort Ausschau halten, das auch bei schlechtem Wetter standhält.“ Dies ist der letzte Satz des Eintrags zu dem Tag, der später „Tag der Befreiung“ heißen sollte. Er bedeutete unter vielem anderen wohl auch das definitive Ende des martialischen deutschen Männerbildes.
Am 14. Mai gibt es wieder Brot. Wasser am Hydranten. Am 18. Mai Lebensmittelkarten. Am 19. Wasser aus der Leitung. Das Leben normalisiert sich als Nachkriegsalltag: Arbeitseinsatz, Hunger, Schwangerschaften. Niedergeschlagenheit und vor allem eine große innere Leere: „Man kann einander jetzt nicht helfen.“ Und, als einer der letzten Sätze des Tagebuchs: „Ich weiß nur, dass ich überleben will – ganz gegen Sinn und Verstand, wie ein Tier.“

13-5-2003
von RENÉE ZUCKER
Kaum zu glauben, wie lange wir auf all diese hervorragenden, erschütternden und tragikomischen Bücher über die Zeit zwischen 1939 und 1947 warten mussten. Seit Mitte der Neunzigerjahre werden sie nach und nach veröffentlicht, die guten Augenzeugenberichte - sei es Margret Bovaris "Tage des Überlebens", Saul Padovers "Lügendetektor, Vernehmungen im besiegten Deutschland" oder Steffen Radlmeiers "Nürnberger Lernprozess". Allen voran erscheint nun dieses großartige Buch, dessen Verfasserin wir noch nicht einmal ehrende Blumen auf das Grab legen können, weil sie sich entschlossen hat, bis über den Tod hinaus anonym zu bleiben.
Einst zog sie durch Europa, zeichnete, fotografierte, studierte. Gebildet, sprachbegabt und gutbürgerlich, wie sie war, stand ihr die Welt offen. So schreibt sie zumindest von sich. Dann kam der Krieg. Was sie zwischen 1939 und 1944 gemacht hat, erfahren wir nicht. Im letzten Kriegsjahr soll sie einen Auftrag in Berlin angenommen haben. Zu der Zeit muss sie um die dreißig Jahre alt gewesen sein.
Der Schriftsteller Kurt Marek, Generationen geplagter Bildungsbürgerkinder auch als C. W. Ceram von "Götter, Gräber und Gelehrte" bekannt, kam 1946 nach Berlin, um vermisste Freunde zu suchen. Er traf dabei auch die Freundin eines Freundes. Sie erzählte ihm von ihrem Tagebuch aus den Wochen zwischen dem 20. April und dem 22. Juni 1945 - er darf es erst sehr viel später lesen, und noch viel später gibt sie ihm die Erlaubnis, es zu veröffentlichen. 1954 erscheinen diese Aufzeichnungen in einem New Yorker Verlag, danach in England, Holland, Schweden, Norwegen, Japan, Spanien, Frankreich. Eine deutschsprachige Ausgabe kommt nur in einem Schweizer Verlag heraus.
Die Filmemacherin Helke Sander war eine der ersten hierzulande, die sich des Schicksals der Frauen im Krieg, insbesondere in den letzten Kriegstagen und ersten Tagen der Nachkriegszeit annahm. In ihrem Film von 1992: "Be-Freier und Befreite" machte sie auf die weithin tabuisierte Tatsache aufmerksam, dass Ende April 1945 in Berlin mindestens 100.000 Frauen und Mädchen von russischen Soldaten vergewaltigt wurden - über 40 Prozent von ihnen mehrfach.
Von solch einem Schicksal wird in diesem Buch berichtet mit einem atemstockend trockenen Humor, der einen abwechselnd lachen und einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Erzählt in einer Lakonie, dass man manchmal die preußisch disziplinierte Marlene Dietrich zu sehen und zu hören glaubt. Anonyma ist so klug wie lebenserfahren: "Keins der Opfer kann das Erlittene wie eine Dornenkrone tragen. Ich wenigstens hatte das Gefühl, dass mir da etwas geschah, was eine Rechnung ausglich", soll sie 1947 gesagt haben. Ceram zitiert es in seinem Nachwort und bewundert, was so ungewöhnlich in diesen Jahren bei den Kriegsbeginnerverlierern war: inmitten der Unmenschlichkeit nach Gerechtigkeit zu fahnden.
Ein Russki "aufm Bauch" sei "nicht so schlimm wie n Ami aufm Kopf", sagt eine Frau, die bei einem Volltreffer mit anderen Hausbewohnern verschüttet war, und auch darin erkennen wir sie wieder, die kaltschnäuzige Berlinerin, wie wir sie immer wieder von der Dietrich, der Knef und auch von Grethe Weiser verkörpert sahen. Das ist so viel deutscher als Goethe und Wagner zusammen - zumindest bei den Frauen.
"Was heißt Schändung? Als ich das Wort zum ersten Mal laut aussprach, Freitagabend im Keller, lief es mir eisig den Rücken herunter. Jetzt kann ich es schon denken, schon hinschreiben, mit kalter Hand, ich spreche es vor mich hin, um mich an die Laute zu gewöhnen. Es klingt wie das Letzte, Äußerste, ist es aber nicht."
Die Tagebuchschreiberin lebt in diesen Tagen in einer Art Wohngemeinschaft, die von den verschiedensten Russen frequentiert wird - schon deshalb, weil es keine Tür mehr gibt, die man schließen könnte, und weil man nicht hoch genug wohnt. Wer weiter oben lebt, hat Glück: Der Russe steigt nicht gerne Treppen Sie lebt mit der so genannten Witwe und deren Untermieter Herrn Pauli, der vornehmlich kränkelt. Wie überhaupt die deutschen Männer nicht wirklich eine besonders herausragende Rolle in diesem Werk spielen. Wie hätten sie auch. Wenn sie überhaupt anwesend waren, mussten sie mit anschauen, wie ihre Frauen und Töchter belästigt, bedroht, verletzt und vergewaltigt wurden - entweder aus purer Triebhaftigkeit und Bösartigkeit der russischen Siegertruppen oder weil es dafür im besten Fall etwas zu essen gab, wovon dann der Mann auch etwas abbekam. Zudem wäre es ihm schlecht bekommen, wenn er versucht hätte, die Frau oder Tochter zu schützen.
Es sind furchtbare Geschichten, die hier erzählt werden, die uns noch einen ganz anderen Blick auf die Generation der so genannten Trümmerfrauen nahe legen. Denn für die gilt ja auch bis heute: "zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl" - wobei das nicht ausschließlich bewundernd, sondern auch Angst einflößend gemeint war. Was dieses Buch trotz seines wirklich unerträglichen Themas so lesenswert macht, ist die Unbestechlichkeit und die Unsentimentalität seiner Autorin. Sie weiß, dass der eigentliche Schrecken nicht in Worten vermittelbar ist, dass nur das sachliche, fast beiläufige Aufzählen einen Hauch jener Wahrheit vermitteln kann, die jahrzehntelang verschwiegen wurde. Und dass über jeder Wahrheit immer noch eine andere und eventuell sogar noch eine dritte liegt.
Diese Wahrheit ergibt sich möglicherweise aus einer Blickrichtung, dem Erzählstil, einer Einstellung zum Leben. Diese Berlinerin ist auf derart einzigartige Weise berlinisch, dass man richtig aufpassen muss, nicht so von ihr fasziniert zu sein, dass man übersieht, wovon sie eigentlich erzählt. Obwohl das wahrscheinlich zusammengehört: die Einzigartigkeit der Situation und das, was sie über sich hinauswachsen lässt.
Sie beharrt auf einer Erkenntnis, die sie "gegen alle Weltverbesserungspläne" vorbringt: "Die Summe der Tränen bleibt konstant. Ganz gleich, unter welchen Fahnen und Formeln die Völker leben, ganz gleich, welchen Göttern sie anhängen und welchen Reallohn sie beziehen: die Summe der Tränen, der Schmerzen und Ängste, mit denen jeder für sein Dasein zahlt, bleibt konstant. Satte Völker suhlen sich in Neurosen und Überdruss. Den im Übermaß Gequälten kommt, wie uns jetzt, Stumpfheit zu Hilfe."
Einen unsentimentaleren Blick als ihren kann man sich kaum vorstellen, obwohl einem an keiner Stelle das Wort "Kälte" in den Sinn gekommen wäre, wie es Ceram in seinem Nachwort als erschreckende Empfindung beim Lesen beschreibt.
Sie sieht sich eine Sechzehnjährige an, die ihre Unschuld an einen Russen verlor, und stellt mitleidlos fest, dass deren Gesicht immer noch so dumm und selbstzufrieden wie vorher ist. Wenn dieses Mädchen im Frieden vergewaltigt worden wäre, so spekuliert Anonyma, wäre ein Verbrechen verfolgt worden. Nun aber, im Krieg, handelt es sich um ein Kollektivschicksal "vorausgewusst, viele Male vorausbefürchtet - um etwas, das den Frauen links und rechts und nebenan zustieß, das gewissermassen dazugehörte. Diese kollektive Massenform der Vergewaltigung wird auch kollektiv bewältigt werden. Jede hilft jeder, indem sie darüber spricht, sich Luft macht, der anderen Gelegeneheit gibt, sich Luft zu machen, das Erlittene auszuspeien." Manchen gelingt diese Heilung durch "Luftmachen" nicht. Sie springen aus dem Fenster oder werden stumpf und verrückt.
"Eine Frau in Berlin" ist ein unglaubliches Buch. Wer das Alphabet gelernt hat, darf und muss es jetzt lesen!
Anonyma: "Eine Frau in Berlin, Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945", 300 Seiten, Eichborn (Die Andere Bibliothek), Frankfurt am Main 2003, 27,50 (Erfolgsausgabe 19,90 )
taz Nr. 7052 vom 13.5.2003, Seite 14, 266 Kommentar RENÉE ZUCKER, Rezension
In den letzten Tagen des April 1945 steht die Rote Armee nur noch wenige Kilometer vor der Hauptstadt des Deutschen Reichs. Zu denen, die trotz heftigen Bombenangriffen und endlosen Nächten in Luftschutzkellern in Berlin ausharrten, gehört auch eine junge Frau. Sie ist Anfang dreissig, arbeitet in einem Verlag und hat, wie sie schreibt, mehrere europäische Länder mit Fotokamera und Notizblock bereist. Nun richtet sie den distanzierten Blick der Berichterstatterin auf das eigene Schicksal und notiert den Zerfall der Zivilisation angesichts der näher rückenden Kämpfe. Die Wasser- und Stromversorgung bricht zusammen, die Verteilung von Lebensmitteln wird zur Lotterie, nur die nationalsozialistische Bürokratie mit ihren Bezugsscheinen und unzähligen Verboten hält sich lange.
Vor allem aber richtet der Krieg die Menschen zu. Noch vor Eintreffen des Feindes befinden sich die Berliner inmitten der Front. «Eine Siebzehnjährige, Granatsplitter, Bein ab, verblutet. Die Eltern haben das Mädchen in ihrem Hausgarten hinter Johannisbeersträuchern begraben. Als Sarg haben sie ihren Besenschrank genommen.» Die Beobachtungen der Frau sind knapp und lakonisch. Die Autorin registriert die allmähliche Abstumpfung, selbst der Sprache: «Ach bitte - wie ist der Mann kaputtgegangen?» - So rede man jetzt: «[. . .] so sind wir sprachlich heruntergekommen.» Die Gewöhnung an den Schrecken, den Abstieg in Abgründe, die Monate zuvor in der geordneten Welt des Berliner Bürgertums unvorstellbar waren, muss man mitbedenken, will man verstehen, wie die Berliner Frauen überstanden, was ihnen in den nächsten Wochen geschah.
Das im Jahr 1954 erstmals in einer amerikanischen Übersetzung publizierte Tagebuch erschien 1959 bei Helmut Kossodo in Genf in deutscher Rückübersetzung, der die vorliegende Neuausgabe, abgesehen von einigen Korrekturen, folgt. Die anonym unter dem Titel «Eine Frau in Berlin» veröffentlichten Aufzeichnungen fügen sich auf ihre Weise ein in eine Reihe von neueren Publikationen über die Leiden der deutschen Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Das Tagebuch der Unbekannten berichtet von einem weiblichen Schicksal und von einem zeitweise verschwiegenen Kapitel des Kriegs: den Massenvergewaltigungen deutscher Frauen durch die sowjetischen Soldaten.
«Erstarrung. Nicht Ekel, bloss Kälte. [. . .] In den Boden versinken - so ist das also.» Die Frauen werden in den nächsten Wochen so häufig missbraucht, dass unter ihnen die Frage «Wie oft?» am Beginn jedes Gespräches steht. Nach wenigen Tagen beschliesst die Schreibende: «Hier muss ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leib hält. Offizier, so hoch es geht, Kommandant, General, was ich kriegen kann.» Zu der Notgemeinschaft zweier Leidensgenossinnen in der halb zerstörten Wohnung gesellt sich erst ein Leutnant, später ein Major. Sie bringen Kameraden mit, und da die Verfasserin Russisch spricht, diskutiert man über Politik. Ein Soldat erzählt, wie Wehrmacht und SS in Russland gehaust haben. Die «Anonyma» widersteht der Versuchung, Schandtat gegen Schandtat aufzurechnen; «die Summe der Tränen bleibt konstant», lautet ihre Bilanz.
Das vom 20. April bis zum 22. Juni 1945 reichende Tagebuch beruht auf flüchtigen Notaten und Stichworten, die Wochen nach Kriegsende ausformuliert und um nachträgliche Beobachtungen ergänzt wurden. Dabei wollte der Text nie mehr sein als ein persönlicher Erlebnisbericht, was ihn in den Rang eines unmittelbaren historischen Zeugnisses erhebt. So schildert die Schreiberin auch, wie die Gewalttaten nach wenigen Wochen verebben und einem halbwegs geregelten Miteinander von Besetzern und Besetzten weichen. In der übrigen sowjetisch okkupierten Zone, vor allem in den Garnisonsstädten, dauern die Vergewaltigungen hingegen auch das folgende Jahr über an und hören erst mit der strikten Kasernierung der sowjetischen Truppen im Jahr 1947 ganz auf. Das Buch belegt, wie die Vergewaltigungen keine vereinzelten Vorkommnisse im Rausch des Sieges waren, sondern ein wiederholtes und von den Vorgesetzten zumeist geduldetes Verbrechen. Wenn man dies berücksichtigt, wirkt es noch befremdlicher, wie wenig darüber bisher in der Bundesrepublik publiziert wurde.
Eine Erklärung für das Schweigen liefert die Verfasserin. In den ersten Nachkriegswochen reden die Frauen noch offen über die Vergewaltigungen, und so nimmt auch die Autorin an, die Opfer würden das Trauma gemeinsam verarbeiten. Sie bemerkt ihren Irrtum jedoch rasch, als sich ihr Freund nach Westen durchschlägt und sie in Berlin wiederfindet. Sie gibt ihm ihr Tagebuch mit der immer wiederkehrenden Abkürzung «Schdg.» zu lesen, deren Bedeutung er nicht versteht. «Ich musste lachen: ‹Na, doch natürlich Schändung.› Er sieht mich an, als ob ich verrückt sei, sagte nichts mehr.» Der Mann reagiert mit Unverständnis, bezeichnet sie und ihre Mitbewohnerin als schamlos «wie Hündinnen» und verlässt sie später. Die Annahme der Frauen, die allgemeine Erfahrung der Vergewaltigungen werde das Reden darüber ermöglichen, erwies sich schnell als Illusion. Die Autorin zog für sich die Konsequenz und bestand darauf, ihre Aufzeichnungen nur unter Geheimhaltung ihrer Identität zu veröffentlichen.
Hinzu kommen politische Gründe - in der DDR ohnehin, aber auch in Westdeutschland, wo die Erwähnung der eigenen Opfer angesichts von Judenvernichtung und Kriegsschuld zeitweise nicht opportun schien. Dreizehn Jahre nach der Wiedervereinigung verschwindet dieser blinde Fleck in der deutschen Erinnerung.
Claudia Schwartz
Anonyma: Eine Frau in Berlin. Tagebuch-Aufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Die Andere Bibliothek, Eichborn-Verlag, Frankfurt am Main 2003. 300 S., Fr. 54.-.
Neue Zürcher Zeitung, 20. August 2003, Ressort Feuilleton
n-tv.de CNN.de
Donnerstag, 8.
Mai 2003
Der
Kadaver von Berlin
Tagebuch des Überlebens
Eine Frau beschreibt die letzten Kriegs- und die ersten
Friedenstage 1945 in Berlin. Ihren Namen erfährt der Leser nicht, nur einige
zufällige Informationen sammeln sich im Lesen an. Sie ist jung, um die 30, hat
in einem Verlag gearbeitet, auch schon etwas von der Welt gesehen. Ihr Art zu
schreiben lässt auf eine gutsituierte Herkunft schließen. Sie hat einen Liebsten
... irgendwo.
Der Krieg neigt sich dem Ende
entgegen, die Aufzeichnungen beginnen an dem Tag "als Berlin zum ersten Mal der
Schlacht ins Auge sah". Da herrscht schon die Ahnung, dass in diesen Teil der
Trümmerhauptstadt die Russen einrücken werden. Im Luftschutzkeller ist das
unvermeidlich Kommende eines der Hauptgesprächsthemen, neben der Beschaffung von
Essen.
Für die "Frau in
Berlin" kommt die erste Vergewaltigung dennoch überraschend und banal. Mit
einigen Brocken Russisch, mitgebracht von einer Reise in Vorkriegszeiten, rettet
sie einige der Mitkellerfrauen vor den ersten Russen. Als die Abwehr geglückt
scheint, wird sie selbst das erste Opfer. Immer wieder fällt sie in den Tagen
darauf den "Frau-suchenden" Russen in die Hände, findet in ihren Tagebüchern die
Abkürzung "Schdg." dafür, was Schändung bedeutet.
In der Beschreibung
finden diese Schändungen eher undramatisch statt. Ein Russe kommt, fordert
unmissverständlich. Die Frauen, irgendwann trifft es jede, fügen sich ins
Unvermeidliche. Selbst die häßlichsten und ältesten Frauen kommen an die Reihe
und sind, so zynisch es klingt, erleichtert. Dann hat man es hinter sich.
Überlebenswille und
Pragmatismus zeichnen "Anonyma" aus. Um der Situation ohne Regeln etwas
Verlässlichkeit abzutrotzen, sucht sie sich hochrangige Beschützer. So kommt
wenigstens nur einer, und der bringt, in Hungerzeiten das beste Argument der
Welt, Brot und Speck mit.
Die da kommen, sind
keine Tiere. Es sind vom Krieg zerstörte Männer, die sich an die Regeln halten,
wie sie in ihrem Land gesetzt wurden. Es sind Männer, die ihre Familien
vermissen und den Sieg auf ihre Weise vollziehen. Moral ist etwas für bessere
Zeiten, das zeigen auch die wenigen deutschen Männer, die in den Aufzeichnungen
vorkommen.
"Kein Mann verliert
sein Gesicht, weil er eine Frau, sei es die eigene, sei es eine Nachbarsfrau,
den Siegern preisgibt. Im Gegenteil, man würde es ihm verdenken, wenn er die
Herren durch Widerstand reizte. Trotzdem bleibt da ein ungelöster Rest."
Die Aufzeichnungen
enthalten indes mehr als nur dies. Darin ist Hunger und Heimatverlust, die Suche
nach einer Zugehörigkeit und das Glück des Überlebens. In all dem verurteilt
Anonyma nicht, weder die anderen, noch sich selbst. Der Schrecken vollzieht sich
im Kopf des Lesers.
Ende Juni, der
Liebste kommt ... und versteht nichts. Die Frau ist erleichtert, als er wieder
geht. Die Zeit des Schreibens ist vorbei, mehr ist kaum zu sagen. Wer dieses
Buch gelesen hat, wird bestimmte Meinungsstandards über das Ende des Krieges
nicht mehr unreflektiert wiedergeben. Es war so, aber eben auch anders.
Solveig Bach
Anonyma
"Eine Frau in Berlin - Tagebuchaufzeichnungen vom 20.
April bis zum 22. Juni 1945",
Eichborn-Verlag Frankfurt/Main, 300 Seiten, 27,50 Euro
|
Politisches Buch
09.05.2003 • 17.45
Anonyma
Eine Frau
in Berlin
Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945
Eichborn Verlag Frankfurt am Main 2003
Rezensiert von Elke Nicolini
Mit einem Nachwort von Kurt W. Marek
Schon der Titel verrät etwas über den Charakter der Verfasserin des Buches: "Eine Frau in Berlin", nicht mehr und nicht weniger. Beiläufig und gleichzeitig die Sprengkraft des Inhalts ahnen lassend dann der Untertitel: "Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945". Notizen also, die mit der Eroberung Berlins durch sowjetische Truppen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnen. Eine Zeit, in der das Wort Russen, keinem mehr über die Lippen will.
"Heute morgen beim Bäcker ging das Gerede: 'Wenn die kommen, holen sie alles Essbare aus den Häusern. Die geben uns nichts. Die haben ausgemacht, dass die Deutschen erst mal acht Wochen hungern sollen. In Schlesien laufen sie schon in die Wälder und graben nach Wurzeln. Die Kinder verrecken. Die Alten fressen Gras wie die Tiere.' Soweit die Vox populi. Man weiß ja nichts."
... So schreibt die Autorin am 20. April. Nein, man wusste nichts in jenen Tagen kurz vor der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen. Selbst der "Völkische Beobachter" erschien nicht mehr. Die Nazizeitung hatte zuletzt die Frauen noch auf die Ankunft der Russen in Berlin vorbereitet, mit Schlagzeilen wie diesen: "Siebzigjährige Greisin geschändet – Ordensschwester vierundzwanzigmal vergewaltigt". Die Tagebuchschreiberin fragt sich, wer da mitgezählt habe. Sie, deren Namen wir nicht kennen, die ihre Aufzeichnungen nur unter der Bedingung der Anonymität veröffentlichen wollte, war nicht bereit, sich von der panischen Furcht, die solche Meldungen bei den Berlinerinnen hervorriefen, anstecken zu lassen. Mit leerem Magen, der ihr den Verstand nicht rauben konnte, beobachtet eine Frau, Anfang dreißig, ihre zertrümmerte Umgebung, in der Chaos, Willkür, Angst und Hunger herrschen; setzt was geschieht ins Verhältnis zu Deutschland und zu sich selbst. Kühl und schonungslos liest sich ihr Bericht. Sie vergleicht, wägt ab, verlässt sich auf ihre eigene Urteilskraft. Wenngleich sie durchaus erfahren muss, dass die Schilderungen des "Völkischen Beobachters" keineswegs nur ein Produkt der Nazipropaganda waren. Am 1. Mai lautet ein Eintrag:
"Was heißt Schändung? Als ich das Wort zum ersten Mal laut aussprach, Freitag Abend im Keller, lief es mir eisig den Rücken herunter. Jetzt kann ich es schon denken, schon hinschreiben mit kalter Hand, ich spreche es vor mich hin, um mich an die Laute zu gewöhnen. Es klingt wie das Letzte und Äußerste, ist es aber nicht."
Wohl selten hat eine Frau über Schändung, die sie am eigenen Leib erfuhr, so distanziert geschrieben. Freilich gibt es Zeugnisse aus jenen Tagen, aber selbst Margret Boveris "Tage des Überlebens in Berlin" reichen nicht an diese atemberaubenden, sogleich nach dem Erlebten niedergeschriebenen Notizen heran. Jedem Wort haftet die Unmittelbarkeit des Geschehens an. Man sieht die Frau am Morgen danach förmlich vor sich, wie sie geschunden und versehrt und doch voller Kraft, den nächsten Tag zu überstehen, in ihre Kladde einträgt, was ihr widerfuhr. Dass sie dabei im Stande ist, zu reflektieren, grenzt an ein Wunder.
Worum geht es? Ums Überleben. Ein Trieb, der sich mit brachialer Gewalt durchsetzt, dem kein Weg zu uneben, zu gefahrvoll erscheint. Wir wissen aus vielen Dokumenten von Opfern von Diktaturen, was Menschen ertragen, in der Hoffnung mit dem Leben davon zu kommen. Denen, die zunächst auf der anderen Seite standen, ist es am Ende in dieser Beziehung ähnlich ergangen, auch wenn ein gravierender Unterschied besteht, der der Frau in Berlin keineswegs entgangen ist:
"Keins der Opfer kann das Erlittene wie eine Dornenkrone tragen. Ich wenigstens hatte das Gefühl, dass mir da etwas geschah, was eine Rechnung ausglich."
Diese Worte zitiert der Herausgeber des Buchs, Kurt W. Marek, in seinem Nachwort, das er für die englische Übersetzung 1954 verfasste. Fünf Jahre später erschienen die Tagebuchaufzeichnungen ziemlich sang- und klanglos auf Deutsch. Jetzt nach dem Tode der Verfasserin hat die Witwe des Herausgebers einer zweiten deutschen Ausgabe zugestimmt, wiederum unter dem Vorbehalt deren Anonymität zu wahren. Die Autorin, eine weitgereiste Frau aus dem Bürgertum, eine wahre Kosmopolitin, die fotografierte und zeichnete und vor dem Krieg offensichtlich in einem Verlag beschäftigt war, blieb in ihrer Heimat, auch wenn Freunde ihr rieten, auszuwandern. Inzwischen glaubt sie, eine Mitschuld zu tragen. Dennoch fühlt sie sich ihrem Volk zugehörig und will "auch jetzt noch", wie sie schreibt, dessen Schicksal teilen. Dass die feindlichen Soldaten in barer Münze kassieren, wirft sie nicht aus der Bahn. Da sie klug ist, versteht sie, was die Sieger umtreibt, weiß zwischen den verschiedenen Mannstypen zu unterscheiden:
"Ab acht Uhr wieder der übliche Betrieb durch die offene Hintertür. Allerlei fremdes Mannsvolk... Meistens kommt aber einer von den uns bereits Bekannten und hilft uns, die Fremden abzuwimmeln. Ich hörte, wie Grischa ihnen das Tabu steckte, wie er Anatols Namen nannte. Und ich bin ganz stolz darauf, dass es mir wirklich gelungen ist, mir einen der Wölfe zu zähmen, wohl den stärksten aus dem Rudel, damit er mir den Rest des Rudels fernhält."
Die Pragmatische hat schnell erkannt, dass es nur eine Chance gibt, von Vergewaltigungen verschont zu bleiben – freilich nicht ohne Preis. Sie wird aktiv und wandelt sich von der Geschändeten zur Liebesdienerin. Ihre Wahl fiel auf den Richtigen, dessen Autorität sie vor den anderen schützt. Ohne ihre Russischkenntnisse, die sie während einer langen Reise durch die Sowjetunion erlangte, wäre ihr dieser Rollentausch kaum möglich gewesen. So aber kommt es, dass in ihrer Hausgemeinschaft mit einer Witwe und deren Untermieter kein Hunger mehr gelitten, Essbares und Schnaps in beinahe fröhlich zu nennenden Runden mit dem "Iwans" konsumiert wird.
Schon bald kursiert im großen Berliner Mietshaus unter den Frauen mit den vielen identischen Erlebnissen ein Jargon. In dem ist von "Essen anschlafen" die Rede, von "Majorszucker", "Schändungsschuhen", von "Plünderwein" und "Klaukohle".
"Es lässt sich keineswegs behaupten, dass der Major mich vergewaltigt. Also tue ich es aus Sympathie, aus Liebesbedürfnis? Da sei Gott vor. Einstweilen hängen mir sämtliche Mannsbilder mitsamt ihren männlichen Wünschen zum Hals heraus, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mich noch einmal im Leben nach diesen Dingen sehnen könnte. Tue ich es für Speck, Butter, Zucker, Kerzen, Büchsenfleisch? Ein wenig bestimmt. Es hat mich bedrückt, an den Vorräten der Witwe mitzehren zu müssen ... Andererseits mag ich den Major, mag ihn um so mehr als Menschen, je weniger er als Mann von mir will....Womit ich die Frage aber noch nicht beantwortet habe, ob ich mich nun als Dirne bezeichnen muss, da ich ja praktisch von meinem Körper lebe und für seine Preisgabe Lebensmittel beziehe."
Angst nistet tief in den Frauen, auch über das Ende des Krieges hinaus. Die Russen erscheinen unberechenbar: Zuviel Alkohol oder ein falsches Wort von den Besiegten, das die Eroberer in ihrer Ehre kränkt, und die freundlichen, kinderlieben Männer verwandeln sich in gefährliche Bestien. Die Tagebuchschreiberin denkt darüber nach, wie viel grausamer junge, unberührte Mädchen die Schändung erleben müssen im Vergleich zu einer erfahrenen Frau. Wie leicht jene daran zerbrechen können. Andererseits sieht sie einen gewissen Trost darin, wie diese Massenform der Vergewaltigung auch kollektiv überwunden wird, in dem jede jeder hilft; jede mit jeder spricht, sich Luft macht über das Erlittene und es nicht im tiefsten Innern vergräbt.
Die Frau in Berlin, die sich durch eine innere Starre schützen konnte, hat uns ein ergreifendes wie erstaunliches Dokument hinterlassen. Erstaunlich, weil sich in ihm keine Spur von Hass findet. Und das mag ein gewichtiger Grund dafür sein, dass sie keinen Moment ihre Würde, ihre Integrität verliert, trotz ihrer Gier zu leben, aus der sie in keiner Zeile einen Hehl macht.
Freitag 21
16-05-2003
Erhard Schütz
ARRANGEMENT MIT DEM AUSNAHMEZUSTAND - Die Erinnerungen einer anonymen Berlinerin an den Nachkrieg in Berlin: »Anonyma«
Es kann so scheinen, als ob mit Jörg Friedrichs
Spektakelbuch über den Bombenkrieg nun vollends die Andenkenindustrie für eine
nostalgische, trotzig-weinerliche deutsche Opferstimmung ihre Konjunktur habe.
Wie anders wäre zu erklären, dass nun ein Buch nach langen Jahrzehnten wieder
aufgelegt wurde, das in den Hochjahren des Kalten Krieges zuerst in den USA
erschien, um später erst in einem randständigen Verlag auf Deutsch nachgetragen
zu werden, das Tagebuch einer anonymen Frau, das über die Monate der russischen
Eroberung und Besetzung Berlins berichtete: Eine Frau in Berlin. Entsprechend
die Reflexe: eine Chronik unablässiger Vergewaltigungen, »schonungslos«,
»erschütternd«.
Während andere, berühmtere Erinnerungen, etwa von Margret Boveri oder Ruth
Friedrich, stets nur die Vergewaltigungen der anderen ringsum notierten,
protokolliert diese anonyme Frau um die Dreißig, ebenfalls gebildet, vorwiegend,
was ihr selbst geschah. Das Tagebuch jedoch lediglich auf seine wahrlich
zahlreichen, mit erschreckend kalter Lakonie aufgeführten »Stellen« hin
öffentlich vorzulesen, würde ihm aber nicht einmal im Ansatz gerecht. Die
»Stellen« sind zudem in der jüngsten Vergangenheit schon benutzt worden, zuletzt
von Anthony Beevor in seinem monumentalen Buch über das Ende Berlins 1945. Was
vielmehr das Unheimliche und Erschreckende ausmacht und das Buch aus der
Jammerkonjunktur entschieden heraushebt, das ist viel mehr der Kontext dieser
»Stellen«. Der ist so intensiv, dass er wie die romanhafte Verdichtung der
ansonsten vielfältig zerstreuten Erinnerungsmomente, Situationen und Erlebnisse
wirkt, intensiver zum Beispiel selbst als Beevors wahrlich episches
Geschichtswerk. Die Intensität gewinnt es vor allem aus einer kalten Lakonie,
einer bis zum Sarkasmus distanzierten Selbstbeobachtung. Sie hat etwas vom
Nüchternheitsgestus und Kältepathos der an Hemingway geschulten
Kriegsberichterstattung. Mithin von dem etwa, wie Walter Kiaulehn in Signal
schrieb oder was Kurt W. Marek damals propagierte, ehe er als C.W. Ceram mit
Götter, Gräber und Gelehrte den Archäologie-Beststeller schlechthin
verfasste.
Ceram/Marek hat das Buch seinerzeit in den USA herausgebracht. Sein Nachwort
vergleicht es mit Hamsun und Céline und beteuert seine Authentizität. Lediglich
Namen und Ortsangaben seien so verändert, dass man die Identität der Schreiberin
nicht erraten könne. Die Rechte am Tagebuch liegen bei der Witwe Mareks. So
beschleicht einen zunächst das Misstrauen, es handele sich um die Erfindung
eines Profis. Doch schnell bemisstraut man das Misstrauen - als Abwehr gegenüber
dem Was - und entschieden mehr noch: wie - da berichtet wird. Wahrscheinlich ist
das Wie überhaupt - und nicht nur hier - die wirkungsvollste Folge aus
jenen Jahren: die wiederholte Sachlichkeit. Schließlich liest man bloß noch, um
den Bericht über die drei Monate zwischen dem 20. April und dem 2. Juni 1945
endlich hinter sich gebracht zu haben.
Am Standrand, schon besetzt, während die Kämpfe langsam in Richtung Innenstadt
vordringen, erleben die Frauen, wie nach den alliierten Bomben nun die
russischen Soldaten buchstäblich über sie hinweggehen. Zu Beginn freilich
funktioniert die Stadt noch immer, das Telefon, die Bahn. Es gibt noch Brötchen.
Bloß Männer gibt es keine mehr: »Sie tun uns leid, erscheinen uns so kümmerlich
und kraftlos. Das schwächliche Geschlecht.« Dann kommen die Russen. Der mehrfach
zitierte, auch späterhin noch kolportierte Spruch »Lieber einen Russen auf dem
Bauch als einen Amerikaner auf den Kopf« erfährt hier seine Probe. Poetische
Betrachtung: »Der Akazienstumpf vor dem Kino schäumt über von Grün« ist ebenso
schnell dahin wie das - nachgetragen prophetische? - Pathos: »Unser Schicksal
rollt von Osten heran und wird unser Klima ändern, wie es einmal die Eiszeit
tat.« werden schnell beiseitegefegt. Dabei wirkt ihre Parade der geklauten
Fahrräder und Uhren zunächst eher belustigend. Doch dann die Vergewaltigungen:
»Ach was, es hat Ihnen bestimmt nicht geschadet. Unsere Männer sind alle
gesund.« Was kurz zuvor noch undenkbar war, wird zur abnormen Normalität: »Was
heißt Schändung? Als ich das Wort zum ersten mal laut aussprach, Freitag Abend
im Keller, lief es mir eisig den Rücken herunter. Jetzt kann ich es schon
denken, schon hinschreiben mit kalter Hand [...]. Es klingt wie das Letzte und
Äußerste, ist es aber nicht.«
Es geht um das, was man zuvor schon hinreichend übte, ums Überleben. »Hier muss
ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leibe hält.« Sie hält sich an Offiziere.
Fortan gibt es für die Vergewaltigungen wenigstens Lebensmittel im Tausch.
»Angst- und Notgemeinschaften« bilden sich unter den Frauen. Man teilt sich die
letzte Vaseline. Die deutschen Männer jammern oder liegen, wie Herr Pauli, der
sich in Gemeinschaft der Schreiberin und der »Witwe« durchfuttern lässt, mit
Migräne im Bett. Inzwischen unterscheidet man auch bei ›den‹ Russen. Ich
»unterscheide die Übelsten von den Erträglichen, gliedere den Schwarm, mache mir
ein Bild von ihnen.« Und: »Wieder ein völlig neues Muster aus der offenbar
unerschöpflichen Mustersammlung, die uns die UdSSR da geschickt hat.«
Bauernburschen bis Hochgebildete: Man säuft und zertrümmert Möbel. Man führt
politische und philosophische Gespräche. Oder hört Werbeplatten von C&A.
Was an dem Bericht besonders gefangen nimmt, ist die Plastizität, in der das
erneute Arrangement mit dem Ausnahmezustand, der Übergang von den Bomben zu den
Übergriffen geschildert wird, Normalisierung der Anomalie. Das Einüben von
Ritualen genauso wie der Austausch von Erfahrungen: Das Bauernvolk scheue die
Treppen, je höher, desto sicherer sei man. Überhaupt drüber zu sprechen, der
»sachliche« Austausch von Zahlen. Die kollektive Bewältigung der kollektiven
Vergewaltigungen. Wovor dann die heimgekehrten Beckmanns Draußen vor der Tür,
wie hier der Freund Gerd am Ende, fassungslos jammernd zusammenbrechen oder sich
davonstehlen werden.
Aber es ist nicht nur der Blick auf den eigensten Kreis zwischen Stube, Keller
und Wasserpumpe, was das Buch so intensiv wirken lässt, sondern die Erweiterung
des Horizonts in der unter diesen brutalsten Umständen schließlich doch
befreiten Stadt. Besonders beeindruckend ein langer Fußmarsch von der Hasenheide
nach Schöneberg - wie mit der Dokumentarkamera. Inzwischen heißen die
»Schändungen« amtlich »Zwangsverkehr«, nach vier Wochen fährt die erste S-Bahn
wieder, das normalisierte Anomale wird nun wieder anomal, dafür gerät man in
eine tristere Normalität, indem man zum Trümmerräumen oder Waschen für die
Russen abkommandiert wird. Fahnen der Sieger werden improvisiert und die ersten
Glücksritter tauchen auf. Was aber bleibt, ist zum einen, im Blick auf Aischylos
Perserklage: »Unser deutsches Unglück hat einen Beigeschmack von Ekel, Krankheit
und ´Wahnsinn, ist mit nichts Historischem vergleichbar.« Und zugleich: »Bin
erst mal für den Mann verdorben.«
Anonyma: Eine Frau in Berlin.
Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945, Eichborn, Frankfurt
am Main 2003, 291 S., 19,90 EUR
|
|
|
|
3. Mai 1945 Den ganzen Nachmittag über war Ruhe; wir sahen keinen von unseren Bekannten mehr, weder Anatol noch Petka, Grischa, Wanja, Jascha oder den Schullehrer Andrej. Dafür erschien bei Anbruch der Dämmerung pünktlich der Major, mit seinem pummeligen usbekischen Schatten und mit noch jemand - gottlob nicht der düsterblonde Leutnant an seinem Stock. Nein, ein kleines, rotbäckiges Bürschlein in blauem Matrosenanzug, achtzehn Jahre alt, Sowjetmarine. Es scheint, dass sie Berlin auch vom Wasser her erobert haben. Seen haben wir ja genug. Das Matröslein sieht aus wie ein Schuljunge und lächelt treuherzig über beide Backen, als er mich halblaut fragt, ob er mich um etwas bitten dürfe.
Bitte sehr! Und ich winke ihn zum Fenster hin, durch das noch immer Brandgeruch hereinweht. Der Matrose ersucht mich dann höflich, ganz kindlich, ich möchte doch so gut sein und ihm ein Mädchen besorgen - aber ein sauberes und ordentliches müsste es sein, ein gutes und liebes - er würde ihm auch zu essen bringen.
Ich starre den Knaben an, habe Mühe, nicht mit Gelächter herauszuplatzen. Das ist denn doch die Höhe. Jetzt fordern sie von ihren besiegten Lustobjekten bereits Sauberkeit und Bravheit und einen edlen Charakter! Fehlt bloß noch ein polizeiliches Führungszeugnis, ehe man sich für sie hinlegen darf! Aber der Kleine blickt so hoffnungsfroh drein, hat die so zarte Haut eines guten Mutterkindes, dass ich ihm nicht böse sein kann. Ich schüttle also mit dem nötigen Bedauern mein Haupt, sage ihm, dass ich erst seit kurzer Zeit in diesem Hause wohne, kaum Leute kenne und ihm leider nicht sagen kann, wo ein gutes, braves Mädchen für ihn zu finden sei. Er nimmt es betrübt zur Kenntnis. Mir zuckt es in den Fingern, ihm hinter die Ohrlöffel zu fahren und nachzufühlen, ob er dort schon trocken ist. Aber ich weiß, dass auch der scheinbar sanfteste Russe jäh zum wilden Tier werden kann, wenn man ihn oder sein Selbstgefühl antastet. Bloß wissen möchte ich, warum ich mir immerfort Kuppelpelze verdienen soll. Wahrscheinlich, weil ich hier herum die einzige bin, die ihre Wünsche sprachlich versteht.
Mein Matrose verzog sich wieder, nachdem er mir dankend seine Kinderpfote gereicht hatte. Warum bloß diese Knäblein so emsig hinter Weiblichem her sind? Daheim würden sie damit wohl noch warten, obwohl sie früher heiraten als unsere Männer. Wahrscheinlich wollen gerade diese Soldatenknaben, wie ja auch der sechzehnjährige Wanja, der Treppenschänder, sich unter ihren älteren Kameraden als vollgültige Männer ausweisen.
Tja, mit dem wilden Drauflosschänden der ersten Tage ist es nichts mehr. Die Beute ist knapp geworden. Und auch andere Frauen sind, wie ich höre, inzwischen genau wie ich in festen Händen und tabu. Über die beiden Sauf- und Jubelschwestern hat die Witwe inzwischen Genaueres vernommen; danach sind bei ihnen bloß Offiziere zugelassen, die es Nichtberechtigten oder gar Hundsgemeinen schwer verübeln, wenn sie Einbrüche in ihr Bettrevier machen. Allgemein versucht ein jeder, der nicht schon zum Abmarsch bereitsteht, etwas Festes, ihm Gehöriges zu finden, und ist bereit, dafür zu zahlen. Dass es bei uns mit dem Essen elend bestellt ist, haben sie begriffen. Und die Sprache von Brot und Speck und Heringen - ihren Hauptgaben - ist international verständlich.
Mir hat der Major alles mögliche mitgebracht, ich kann nicht klagen. Unter dem Mantel trug er einen Packen Kerzen. Dazu weitere Zigarren für Pauli. Der Usbek war schwer beladen, kramte nacheinander eine Büchse Milch, eine Büchse Fleisch und einen Kanten salzstarrenden Specks heraus; dann einen in Lappen gewickelten Butterkloß von mindestens drei Pfund, mit Wollhärchen verschmiert, die die Witwe gleich abklaubte, und, als wir dachten, es käme nichts mehr, noch einen Kissenbezug, in den viel Zucker gefüllt war, schätzungsweise fünf Pfund! Das sind fürstliche Morgengaben. Herr Pauli und die Witwe staunten.
Die Witwe lief, um die Gaben in ihrem Küchenschrank zu verstauen. Herr Pauli und der Major qualmten einander freundschaftlich an, und ich saß dabei und grübelte. Dies ist eine neue Sachlage. Es lässt sich keinesfalls behaupten, dass der Major mich vergewaltigt. Ich glaube, dass ein einziges kaltes Wort von mir genügt, und er geht und kommt nicht mehr. Also bin ich ihm freiwillig zu Diensten. Tue ich es aus Sympathie, aus Liebebedürfnis? Da sei Gott vor. Einstweilen hängen mir sämtliche Mannsbilder mitsamt ihren männlichen Wünschen zum Hals heraus, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich mich noch einmal im Leben nach diesen Dingen sehnen könnte. Tue ich es für Speck, Butter, Zucker, Kerzen, Büchsenfleisch? Ein wenig bestimmt. Es hat mich bedrückt, an den Vorräten der Witwe mitzehren zu müssen. Ich freue mich, dass ich ihr nun, durch die Hände des Majors, auch etwas geben kann. Ich fühle mich freier so, esse mit besserem Gewissen. Andererseits mag ich den Major, mag ihn umso mehr als Menschen, je weniger er als Mann von mir will. Und viel wird er nicht wollen, das spüre ich. Sein Gesicht ist bleich. Die Kniewunde macht ihm zu schaffen. Wahrscheinlich sucht er menschliche, weibliche Ansprache mehr als das bloß Sexuelle. Und die gebe ich ihm gutwillig, ja gern. Denn unter den Mannsviechern der letzten Tage ist er doch der erträglichste Mann und Mensch. Ihn kann ich überdies lenken. Das würde ich mir bei Anatol nicht so ohne weiteres zutrauen, obwohl Anatol mir gegenüber die Gutmütigkeit selber war. Aber so gierig, so Bulle, so stark! Unwillkürlich würde er mir doch eine kleine Ohrfeige hauen, bei der ich ans Zähnespucken käme - einfach so, aus Überschuss an Kraft, aus Bärenhaftigkeit. Mit dem Major hingegen lässt sich reden. Womit ich die Frage aber noch nicht beantwortet habe, ob ich mich nun als Dirne bezeichnen muss, da ich ja praktisch von meinem Körper lebe und für seine Preisgabe Lebensmittel beziehe.
Wobei ich, während ich dies schreibe, erst einmal überlegen muss, warum ich mich so moralisch gehabe und so tue, als sei der Dirnenberuf tief unter meiner Würde. Es ist immerhin ein altes, ehrwürdiges Gewerbe und reicht hinauf bis in die höchsten Kreise. Ein einziges Mal allerdings nur hab ich mit einer solchen Frau gesprochen; das heißt mit einer eingetragenen, offiziell diesem Beruf nachgehenden Frau. Es war auf einem Schiff im Mittelmeer, irgendwo nahe der afrikanischen Küste; ich war sehr früh aufgestanden und trieb mich an Deck herum, während noch Matrosen die Planken schrubbten. Eine Frau war auch schon auf, mir unbekannt, dicklich, bescheiden angetan, zigarettenrauchend. Ich stellte mich zu ihr an die Reling, sprach sie an. Sie konnte ein paar Brocken Englisch, nannte mich Miss, bot mir eine Zigarette aus ihrer Schachtel und lächelte dazu. Später fing mich der Obersteward ab und teilte mir in dramatischem Flüsterton mit, das da sei eine schlechte Person; man müsse sie mitnehmen, lasse sie aber nur in der Frühe, wenn gewöhnlich noch keiner von den Passagieren auf sei, an Deck. Ich sah sie später nicht mehr, sehe aber noch ihr dickliches, freundliches Frauengesicht vor mir. Was das schon heißt - schlecht!
Aber könnte ich, vom Moralischen mal ganz abgesehen, in dieses Gewerbe hineinrutschen, mir darin gefallen? Nein, niemals. Es geht mir wider die Natur, kränkt mein Selbstgefühl, zerstört meinen Stolz - und macht mich körperlich elend. Da also hat es keine Not. Ich steige aus diesem Gewerbe, wenn ich mein derzeitiges Tun schon so nennen muss, mit tausend Freuden aus - wenn ich nur mein Essen wieder auf andere, angenehmere, meinem Stolz besser zusagende Weise verdienen kann.
Gegen 22 Uhr verstaute der Major seinen Usbeken hinter der Küche in die Kammer. Wieder klirrt ein Koppel am Bettpfosten, baumelt der Revolver herab, krönt die Soldatenmütze den Pfostenknauf. Aber die Kerze brennt noch, und wir erzählen uns allerlei. Das heißt, der Major erzählt, er berichtet mir von seinen Familienverhältnissen und kramt aus seiner Brieftasche kleine Fotobildchen heraus. Zum Beispiel ein Bild von seiner Mutter, die zu weißem Haar wilde, schrägschwarze Augen hat. Sie stammt aus dem Süden des Landes, wo von jeher die Tataren saßen, und hat einen weißblonden Sibirier geheiratet. Äußerlich hat der Major viel von seiner Mutter. Sein Wesen wird mir nun aus dieser nordsüdlichen Blutmischung verständlich: seine Sprunghaftigkeit, der Wechsel von Hast und Schwere, von Feuer und Melancholie, seine lyrischen Aufschwünge und die plötzliche Misslaune hinterher. Er war verheiratet, ist seit langem geschieden, war offenbar ein schwieriger Partner, wie er selber gesteht. Kinder hat er keine. Das ist etwas sehr seltenes bei einem Russen. Ich merkte es daran, dass sie immer gleich fragten, ob ich Kinder hätte, und mir gegenüber kopfschüttelnd ihre Verwunderung darüber kundtaten, dass es bei uns so wenig Kinder gibt und so viele Frauen ohne Kind. Auch der Witwe wollen sie gar nicht glauben, dass sie keine Kinder hat.
Noch ein Foto zeigt mir der Major, das Porträt eines sehr gut aussehenden, streng gescheitelten Mädchens, Tochter eines polnischen Universitätsprofessors, bei dem der Major im letzten Winter in Quartier lag.
Als der Major meine familiären Verhältnisse anbohrt, weiche ich aus, mag davon nicht sprechen. Er will dann wissen, welche Schulbildung ich genossen habe, vernimmt achtungsvoll, was ich ihm vom Gymnasium und den gelernten Fremdsprachen und meinen Reisen kreuz und quer durch Europa berichte. Er sagt anerkennend: "Du hast eine gute Qualifikation." Wundert sich dann unvermittelt, dass die deutschen Mädchen alle so schlank und fettlos seien - ob wir so wenig zu essen bekommen hätten? Er malt sich dann aus, wie es wäre, wenn er mich mitnähme nach Russland, wenn ich seine Frau wäre, seine Eltern kennen lernte ... Er verspricht, mich dort mit Hühnchen und Sahne dick zu füttern, denn vor dem Krieg habe man bei ihm daheim recht gut gelebt ... Ich lasse ihn spinnen. Fest steht, dass meine "Bildung" - die er freilich nach bescheidenem Russenmaßstab misst - ihm Achtung einflößt, mich in seinen Augen begehrenswert macht. Gewiss ein Unterschied zu unseren deutschen Männern, für die nach meinen Erfahrungen Belesenheit keineswegs den Reiz einer Frau erhöht. Im Gegenteil, instinktiv hab ich mich stets ein bisschen dümmer und unwissender gestellt den Männern gegenüber oder hab doch hinterm Berge gehalten, bis ich sie näher kannte. Der deutsche Mann möchte stets der Klügere sein und sein kleines Frauchen belehren. Die Sowjetmänner wissen nichts von kleinen Frauchen fürs traute Heim. Bildung steht dort so hoch im Kurs, ist ein so rares, so gesuchtes, dringend benötigtes Gut, dass man sie von Staats wegen mit strahlendem Nimbus umgibt. Hinzu kommt, dass Wissen sich dort bezahlt macht, was auch der Major sagen will, als er mir nun darlegt, dass ich in seiner Heimat bestimmt "qualifizierte Arbeit" finden würde. Schönen Dank, du meinst es gut, aber damit bin ich ein für allemal bedient. Bei euch gibt es zu viel Abendkurse. Ich mag keine Abendkurse mehr. Ich mag Abende für mich.
Freitag, 20. April 1945, 16 Uhr: Ja, der Krieg rollt auf Berlin zu. Was gestern noch fernes Murren war, ist heute Dauergetrommel. Man atmet Geschützlärm ein. Zwischendurch Stunden von unheimlicher Lautlosigkeit. Plötzlich fällt einem der Frühling ein. Durch die brandschwarzen Ruinen der Siedlung weht in Schwaden Fliederduft aus herrenlosen Gärten.
Freitag, 23 Uhr, im Keller, bei Petroleum- licht: Gegen 22 Uhr fielen hintereinander drei oder vier Bomben. Gleichzeitig heulte die Sirene los. Nichts Fremderes als ein fremder Keller. Ich gehöre nun seit fast drei Monaten dazu und fühle mich trotzdem noch fremd. Jeder Keller hat andere Tabus, andere Ticks. In meinem alten Keller hatten sie den Löschwassertick. Allerorten stieß man sich an Kannen, Eimern, Töpfen, Fässern, in denen eine trübe Brühe stand. Trotzdem ist das Haus wie eine Fackel heruntergebrannt.
Samstag, 21. April 1945, 2 Uhr nachts: Bomben, die Mauern schwanken. Meine Finger zittern noch am Füller. Ich bin nass wie nach schwerer Arbeit. Seit ich ausgebombt bin und in der gleichen Nacht beim Bergen Verschütteter half, laboriere ich an meiner Todesangst. Jetzt beten können. Das Hirn krallt sich an Formeln, Satzfetzen: „Geh an der Welt vorüber, es ist nichts...“ Jeder neue Lebenstag ist ein Triumphtag. Man hat es wieder mal überlebt. Man trotzt.
Montag, 23. April 1945, 9 Uhr früh: Verblüffend ruhige Nacht, kaum Flak. Ein neuer Kellerbürger kreuzte auf. Der Mann kam in Uniform, trug eine Stunde später Räuberzivil. Wieso? Keiner spricht davon. Desertion erscheint plötzlich als selbstverständlich, ja geradezu erfreulich. Wir Frauen sind vernünftig, praktisch, opportunistisch. Wir sind für lebende Männer. Neue Lebensmittelmarken sind nicht in Sicht. Überhaupt kein Befehl mehr, keine Nachrichten, nichts. Es kümmert sich kein Schwein mehr um uns.
Wüst sieht die Berliner Straße aus, halb aufgerissen und von Barrikaden versperrt. Dort hält Volkssturm Wacht, blutjunge Kinder, Milchgesichter mit viel zu großen Stahlhelmen. Die können höchstens fünfzehn sein. Warum sträubt sich das Gefühl so sehr gegen diesen Kindermord? Sind die Kinder erst drei, vier Jahre älter, so erscheint uns ihr Erschossen- und Zerrissenwerden doch ganz natürlich.
Dienstag, 24. April 1945, mittags: In die Fleischschlange bei Hefter ist ein Volltreffer gefallen. Drei Tote, zehn Verletzte – aber die Schlange steht schon wieder. Die Witwe (eine Nachbarin) macht vor, wie die Umstehenden mit ihren Ärmeln Blutspritzer von den Fleischkarten gewischt haben. Sie meint dann: „Na ja, nur drei Tote. Was ist das schon, wenn man an einen Luftangriff denkt.“ Ja, wir sind verwöhnt.
Am Horizont Rauch und Röte. Der Osten brennt. Es heißt, die Russen stehen schon an der Braunauer Straße. Ausgerechnet Braunau, der Ort, an dem Adolf das Licht der Welt erblickte. Wobei mir ein Kellerwitz einfällt, gestern vernommen: „Junge, wie gut könnten wir’s haben, wenn det ’ne Fehlgeburt geworden wäre.“
Freitag, 27. April 1945, Tag der Katastrophe: Da haben sie mich. Die beiden haben hier gelauert. Ich schreie, schreie... Hinter mir klappt dumpf die Kellertür zu. Der eine zerrt mich an den Handgelenken weiter, den Gang hinauf. Nun zerrt auch der andere, wobei er mir seine Hand so an die Kehle legt, dass ich nicht mehr schreien kann. Beide reißen sie an mir, schon liege ich am Boden.
Ich komme mit dem Kopf auf der untersten Stufe der Kellertreppe zu liegen, spüre im Rücken nasskühl die Fliesen. Oben am Türspalt, durch den etwas Licht fällt, hält der eine Mann Wache, während der andere an meinem Unterzeug reißt, sich gewaltsam den Weg sucht.
Mit der Rechten wehre ich mich, es hilft nichts, den Strumpfhalter hat er einfach durchrissen. Als ich taumelnd hochzukommen versuche, wirft sich der zweite über mich, zwingt mich mit Fäusten und Knien an den Boden zurück. Nun steht der andere Schmiere, er flüstert: Schnell, schnell...“
Endlich tun sich beide eiserne Hebel auf. Drinnen starrt mich das Kellervolk (die Nachbarn) an. Jetzt erst merke ich, wie ich aussehe. Die Strümpfe hängen mir auf die Schuhe herunter, das Haar ist zerzaust, die Fetzen des Strumpfhalters habe ich noch in der Hand.
Ich schreie los: „Schweine ihr! Zweimal geschändet, und ihr macht die Tür zu und lasst mich liegen wie ein Stück Dreck.“
Nach der Vergewaltigung beschwert sie sich bei einem russischen Kommandanten:
Er lacht aber bloß über mein Gestammel. „Ach was, es hat Ihnen bestimmt nichts geschadet. Unsere Männer sind alle gesund.“ Er schlendert zu den anderen Offizieren zurück, wir hören sie halblaut lachen.
Am gleichen Tag die nächste Vergewaltigung.
Riesenpratzen, Schnapsdunst. Mein Herz hüpft wie verrückt. Ich flüstere, ich flehe: „Nur einer, bitte, bitte, nur einer. Meinetwegen Sie. Aber schmeißen Sie die anderen raus.“
Mir ist taumelig, ich bin nur noch halb da, und diese Hälfte wehrt sich nicht mehr. Mein Ich lässt den Leib, den armen, verdreckten, missbrauchten, einfach liegen. Es entfernt sich von ihm und entschwebt rein in weiße Fernen. Es soll nicht mein „Ich“ sein, dem dies geschieht.
Sonntag, 29. April 1945: In der Pumpenschlange erzählt eine Frau, wie in ihrem Keller ein Nachbar ihr zugerufen habe, als die Iwans an ihr zerrten: „Nu gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!“ Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes.
Immer wieder ekelt es mich in diesen Tagen vor meiner eigenen Haut. Ich mag mich nicht anrühren, kaum noch anschauen. Muss daran denken, was mir die Mutter so oft erzählt hat von dem kleinen Kind, das ich einmal war. Ein Baby so weiß und rosa, wie es stolze Eltern freut. So viel Liebe, so viel Aufwand mit Häubchen, Badethermometern und Abendgebet für den Unflat, der ich jetzt bin.
Montag, 30. April 1945: Immer noch Krieg draußen. Und unser neues Morgen- und Abendgebet: „Dies alles verdanken wir dem Führer.“ Ein Satz, der in den Friedensjahren tausend Mal als Lob und Dank auf Plakate gemalt wurde. Nun wird er zu Hohn und Spott.
Dienstag, 1. Mai 1945
Wir sind im Dreck, tief, tief. Jede Minute Leben wird teuer bezahlt.
Von draußen hallen russische Laute herein. Iwan spricht mit seinen Gäulen. Zu den Pferden sind sie weit freundlicher als zu uns.
Samstagnachmittag gegen 15 Uhr schlugen zwei mit Fäusten und Waffen gegen die Vordertür, brüllten rau, traten gegen das Holz. Die Witwe (eine Nachbarin) öffnete.
Der eine greift nach mir, treibt mich in das vordere Zimmer. Ein älterer Mensch mit grauen Bartstoppeln, er riecht nach Schnaps und Pferden. Augen zu, Zähne fest zusammengebissen.
Kein Laut. Bloß als das Unterzeug krachend zerreißt, knirschen unwillkürlich die Zähne. Die letzten heilen Sachen.
Auf einmal Finger in meinem Mund, Gestank von Gaul und Tabak. Ich reiße die Augen auf. Geschickt klemmen die fremden Hände mir die Kiefer auseinander. Auge in Auge. Dann lässt der über mir aus seinem Mund bedächtig den angesammelten Speichel in meinen Mund fallen.
Als ich aufstand, Schwindel, Brechreiz. Die Lumpen fielen mir auf die Füße. Ich torkelte ins Bad. Erbrechen. Das grüne Gesicht im Spiegel.
Sagte dann laut: Verdammt! und fasste einen Entschluss.
Ganz klar: Hier muss ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leibe hält. Offizier, so hoch es geht, Kommandant, General, was ich kriegen kann.
Hab darüber nachdenken müssen, wie gut ich es bisher gehabt habe, dass mir in meinem Leben die Liebe niemals zur Last und immer zur Lust war. Bin nie gezwungen worden, hab mich niemals zwingen müssen. Es ist nicht das Allzuviel, was mich jetzt so elend gemacht hat. Es ist der missbrauchte, wider seinen Willen genommene Körper, der mit Schmerzen antwortet.
Frigide blieb ich bisher bei all diesen Beiwohnungen. Es kann, es darf nicht anders sein, ich will tot und gefühllos bleiben, solange ich Beute bin.
Mittwoch, 2. Mai 1945
Die Tagebuch-Schreiberin sucht sich einen Major, der ihr als „Beschützer“ die anderen Männer vom Leib hält:
Hab ihm gesagt, wie elend und wund ich bin und dass er sanft sein soll. Er war sanft und wortlos zärtlich, gab bald Ruhe, ließ mich schlafen.
Donnerstag, 3. Mai
Mit dem wilden Drauflosschänden der ersten Tage ist es nichts mehr. Die Beute ist knapp geworden. Und auch andere Frauen sind inzwischen genau wie ich in festen Händen und tabu.
Es lässt sich keinesfalls behaupten, dass der Major mich vergewaltigt. Ich glaube, dass ein einziges, kaltes Wort von mir genügt, und er geht und kommt nicht mehr. Also bin ich ihm freiwillig zu Diensten.
Tue ich es aus Sympathie, aus Liebebedürfnis? Da sei Gott vor. Einstweilen hängen mir sämtliche Mannsbilder mitsamt ihren männlichen Wünschen zum Hals heraus.
Tue ich es für Speck, Butter, Zucker, Kerzen, Büchsenfleisch? Ein wenig bestimmt. Andererseits mag ich den Major, unter den Mannsviechern der letzten Tage ist er doch der erträglichste Mann und Mensch. Ihn kann ich überdies lenken.
Womit ich die Frage aber noch nicht beantwortet habe, ob ich mich nun als Dirne bezeichnen muss, da ich ja praktisch von meinem Körper lebe.
Samstag, 5. Mai 1945
Ein 17-jähriger Russe berichtet seine Erlebnisse.
Er sieht mich mit streng gerunzelter Stirn an und fordert mich auf zu
übersetzen, dass deutsche Militärs in seinem Heimatdorf Kinder erstochen hätten
und andere bei den Füßen gefasst hätten, um ihre Schädel an der Mauer zu
zertrümmern. Ehe ich das übersetze, frage ich: „Gehört? Oder selbst mit
angesehen?“ Er, streng vor sich hin: „Zweimal selber gesehen.“ Ich übersetze.
„Glaub ich nicht“, erwidert Frau Lehmann. „Unsere Soldaten? Mein Mann? Niemals!“
Schweigen. Wir starren alle vor uns hin. Ein Schatten steht im Raum. Mir steigt ein Klumpen in die Kehle.
Donnerstag, 10. Mai 1945
Ein Pferd verendet auf der Straße – die hungernden Menschen stürzen sich darauf.
Das Tier zuckte noch und verdrehte die Augen, da stachen schon die ersten Brotmesser und Taschenmesser in den Leib. Ein jeder schnitt und wühlte, wo er gerade angefangen hatte.
Die Eigentumsbegriffe sind völlig zerrüttet: Jeder bestiehlt jeden, weil jeder bestohlen wurde und jeder alles brauchen kann.
Donnerstag, 17. Mai 1945
Seit der russische Major versetzt wurde, muss die junge Frau sich von Brennnesseln und fauligen Kartoffeln ernähren: Das Wölfische im hungernden Menschen überwiegt. Ich warte auf den Augenblick, wo ich zum ersten Mal im Leben einem Schwächeren sein Stück Brot aus der Hand reißen werde.
Mittwoch, 23. Mai 1945
Mit Eimer und Müllschippe ausgerüstet, marschierte ich in grauer Regenfrühe zum Rathaus. Es regnete immerzu, mal feiner, mal stärker. Trotzdem schippten wir und füllten Eimer auf Eimer mit Dreck, damit die Händekette nicht abriss. Rückkehr zu den Pyramidenzeiten, nur dass wir nicht aufbauen, sondern abtragen.
Sonntag, 27. Mai 1945
Seit gestern haben wir wieder elektrischen Strom. Das Radio wird vom Berliner Sender beschickt. Es bringt meistens Nachrichten und Enthüllungen, Blutgeruch, Leichen und Grausamkeit. In großen Lagern im Osten sollen Millionen Menschen verbrannt worden sein, meistens Juden. Aus ihrer Asche sollen die Kunstdünger hergestellt haben. Und was das Tollste ist: Alles das soll in dicken Büchern säuberlich notiert sein, eine Buchführung des Todes. Wir sind eben ein ordentliches Volk. Spätabends kam Beethoven – und damit kamen Tränen. Hab abgedreht. Man verträgt das jetzt nicht.
Von Samstag, 16. Juni, bis Freitag, 22. Juni 1945:
Es war Samstag gegen fünf Uhr nachmittags, als es draußen klingelte. „Die Witwe“, so dachte ich. Doch es war Gerd, in Zivil, braun gebrannt, das Haar heller denn je.
Wir sagten beide eine Zeitlang gar nichts, starrten uns in dem dämmrigen Flur an wie zwei Gespenster.
„Wo kommst du her? Bist du entlassen?“ „Nee, ich bin versickert. Aber nun lass mich erst mal rein.“
Ich war fiebrig vor Freude. Fand mich trotzdem zur Nacht eiskalt in Gerds Armen wieder, war froh, als er mich ließ. Bin erst mal für den Mann verdorben.
Unregelmäßige Tage, unruhige Nächte. Allerlei Leute, die mit Gerd getreckt sind, kamen uns besuchen.
Saß ich stumm dabei, schimpfte er. War ich aufgekratzt, gab ich Stories zum besten, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben, so kam es nachher erst recht zum Streit.
Gerd: „Ihr seid schamlos wie die Hündinnen geworden, ihr alle miteinander hier im Haus. Merkt ihr denn das nicht?“
Er verzog angewidert sein Gesicht: „Es ist entsetzlich, mit euch umzugehen. Alle Maßstäbe sind euch abhanden gekommen.“
Was sollte ich antworten? Ich hab mich verkrochen und hab gebockt. Weinen konnte ich nicht, alles kam mir so sinnlos, so dumm vor.
Ich hab Gerd inzwischen meine Tagebuchhefte gegeben. (Es sind drei Kladden voll geworden.)
Gerd setzte sich eine Weile darüber, gab mir dann die Hefte zurück, meinte, er könne sich nicht durchfinden durch mein Gekritzel.
„Was soll das zum Beispiel heißen?“, fragte er und deutete auf „Schdg.“. Ich musste lachen: „Na, doch natürlich Schändung.“ Er sah mich an, als ob ich verrückt sei, sagte nichts mehr.
Seit gestern ist er wieder fort. Mit einem Kameraden will er lostrampen, zu dessen Eltern in Pommern. Will Nahrungsmittel heranholen. Ich weiß nicht, ob er wiederkommt. Es ist schlimm, aber ich fühle mich erleichtert.
Manchmal wundere ich mich darüber, dass ich nicht stärker leide unter dem Zerwürfnis mit Gerd, der mir doch sonst alles war. Mag sein, dass der Hunger die Gefühle dämpft.
Ich hab so viel zu tun. Muss schauen, dass ich ein Stück Feuerstein finde für das Gas; denn die letzten Streichhölzer sind verbraucht.
Ich muss die Regenpfützen in der Wohnung aufwischen; das Dach leckt wieder. Ich muss herumlaufen und Grünzeug an den Straßenrändern suchen.
Ich habe keine Zeit für ein Seelenleben. Ich weiß nur, dass ich überleben will – ganz gegen Sinn und Verstand, einfach wie ein Tier.
Ob Gerd noch an mich denkt? Vielleicht finden wir doch wieder zueinander
|
ZEITUNG |
DATUM |
AUTOR |
TITEL |
|
Die Tageszeitung |
30-9-2003 |
Renée Zucker |
Erfahrung einer Generation |
|
Süddeutsche Zeitung |
24-9-2003 |
Jens Bisky |
Wenn Jungen Weltgeschichte spielen, haben Mädchen... |
|
Neue Zürcher Zeitung |
1-10-2003 |
Joachim Güntner |
Verdächtigung ohne Beleg |
|
Frankfurter Allgemeine Zeitung |
25-9-2003 |
Felicitas von Lovenberg |
Eine Frau in Berlin |
|
Der Spiegel |
29-9-2003 |
Verdeckte Ermittlungen von Schnüfflern |
|
|
Frankfurter Rundschau |
21-12-2003 |
Ursula März |
Das Prinzip Aussitzen |
|
Frankfurter Allgemeine Zeitung |
19-1-2004 |
Felicitas von Lovenberg |
Walter Kempowski über das Tagebuch..... |
|
Neue Zürcher Zeitung |
19-1-2004 |
Joachim Güntner |
Walter Kempowski legt Gutachten vor |
|
Süddeutsche Zeitung |
21-1-2004 |
Gustav Seibt |
Kieselsteine zählen |
|
Frankfurter Rundschau |
19-1-2004 |
Ina Hartwig |
Kempowski über Anonyma |
|
Berliner Zeitung |
20-1-2004 |
che |
Aufgegossen im Sinne Jüngers |
|
The Independent |
17-6-2005 |
Joanna Bourke |
Living with a brutal bear |
|
The Observer |
2-7-2005 |
Linda Grant |
The rubble women |
|
The Daily Telegraph |
4-7-2005 |
Cressida Connolly |
She screamed for help but her neighbours... |
Lesen Sie diese Artikeln hier
|
ZEITUNG |
DATUM |
AUTOR |
TITEL |
|
San Francisco Chronicle |
7-8-2005 |
Edie Meidav |
|
|
Los Angeles Times |
5-8-2005 |
Kai Maristed |
Raising her voice in war's aftermath |
|
The New York Times |
14-8-2005 |
Joseph Kanon |
'Woman in Berlin': My City of Ruins |
|
The Boston Globe |
14-8-2005 |
Richard Eder |
Tearing down the gates |
|
Salon.com |
18-8-2005 |
Jonathan Shainin |
The rape of Berlin |
|
The Washington Post |
4-9-2005 |
Ursula Hegi |
After the fall |
|
The Daily Telegraph |
4-9-2005 |
Nigel Jones |
At the very extreme of human suffering |
|
|
|
|
|
Lesen Sie diese Artikeln hier