17-7-2007
Schweigen tut weh: Eine deutsche Familiengeschichte, von Alexandra Senfft
Stille Post: Eine andere Familiengeschichte, von Christina von Braun
![]()
25-06-2007
Die Familie des Nazi-Verbrechers Ludin
Selbstmord auf Raten
Hanns Ludin war einer von Hitlers willigen Vollstreckern - mit Folgen für seine Nachkommen. Einige Kinder halten den Nazi nach wie vor für einen ehrenwerten Mann - Tochter Erika trieb die Vergangenheit in den Tod.
Von Eva Menasse
ALEXANDRA SENFFT: Schweigen tut weh. Eine deutsche Familiengeschichte. Claassen Verlag, Berlin 2007. 320 Seiten, 19,95 Euro.
"Mein Vater war ein Nazi" - dieser Satz hat für die erste Nachkriegsgeneration
der Deutschen eine immense Rolle gespielt. Durfte, konnte man diesen Satz sagen,
sogar, wenn man musste? Anfangs war diese Auseinandersetzung wohl überhaupt nur
mit einem lebenden Gegenüber möglich.
Als Niklas Frank seinen in Nürnberg gehängten Vater Hans Frank, den "Schlächter
von Polen", 1987, also 41 Jahre nach dessen Tod, sachlich richtig in aller
Öffentlichkeit einen "Nazimörder" schimpfte, klang sein Ton schockierend, denn
mit denen, die "mit dem Leben gebüßt hatten", hatte noch kein Kind öffentlich
gehadert. Das schien erledigt, dabei war es das Gegenteil, eine jahrzehntelang
unversorgte Wunde.
"Mein Vater war ein Nazischwein", diesen Satz konnte Erika Senfft, geborene
Ludin, nur spät und ganz selten sagen, und nur, wenn sie schwer betrunken war.
Denn mit Niklas Frank hatte Erika Senfft gemeinsam, dass ihr geliebter Vater
hingerichtet wurde, lange bevor sie in einem Alter war, wo sie seine Taten auch
nur ansatzweise hätte begreifen können.
Für ein Kind
ist das eine fatale Ausgangslage.
Hanns E. Ludin war von Januar 1941 an Hitlers
Gesandter in der Slowakei. Während er Deportationsbefehle für die slowakischen
Juden unterzeichnete, verbrachten Erika und ihre fünf jüngeren Geschwister
goldene Kindheitsjahre in einer Villa in Bratislava - ein Foto von den sechs
lachenden Blondschöpfen im Gras erinnert fatal an die Goebbels-Kinder. An kaum
einem Ort in Europa war der Krieg so wenig zu spüren wie in Hitlers friedlichem
Satellitenstaat. Vielleicht kam für diese Kinder das Ende daher besonders
unerwartet.
Plötzlich findet sich Ludins Frau Erla mit ihren sechs Kindern auf einem
Bauernhof in Süddeutschland wieder, die Älteste, Erika, noch keine zwölf, in der
typischen Rolle als Stütze und Partnerersatz. Der Vater ist verschwunden, erst
auf der Flucht, dann stellt er sich den Alliierten.
Ein fast dreijähriges Hoffen, Bangen und Briefeschreiben beginnt, auch hier ist
Erika als ältestes Kind am meisten involviert. Ludin wird nach Bratislava
ausgeliefert. Als er im Dezember 1947 hingerichtet wird, ist die vierzehnjährige
Erika bereits im Internat in Salem. Sie muss mit dem Unbegreiflichen allein
zurechtkommen, während die Klassenkameraden hinter ihrem Rücken tuscheln.
Für den Film den Tod der Mutter abgewartet
Im Jahr 2005 hat Ludins jüngster Sohn Malte, beim
Tod des Vaters erst fünf Jahre alt, in seinem großartigen Dokumentarfilm "2 oder
3 Dinge, die ich von ihm weiß" gezeigt, was diese Vater-Leerstelle in seiner
Familie auf Jahrzehnte angerichtet hat. Hier konnte man das ganze deutsche Drama
als beklemmendes familiäres Kammerspiel besichtigen.
Da war die majestätische Witwe Erla, die nach dem sogenannten Röhm-Putsch ihren
Mann mit dem Satz "Wo gehobelt wird, da fallen Späne" getröstet hatte und die
später das Andenken des Kriegsverbrechers so eisern hochhielt, dass manche ihrer
Enkel eine Weile lang sogar glaubten, der Großvater sei als Widerstandskämpfer
hingerichtet worden. "Solange sie lebte, hätte ich mich an diesen Film nicht
gewagt", sagt Malte Ludin zu Beginn des Films, "und sie lebte lange".
Nach Erlas Tod haben ihre Töchter Barbel, Ellen und Andrea bereitwillig die
tragenden Rollen der Verdrängung übernommen, indem sie ihren Vater bis heute mit
erheblicher psychischer Kraftanstrengung für einen ehrenwerten Mann halten
wollen. "Er hat ja nicht mit der Pistole irgendwo gestanden oder den Schlüssel
zur Gaskammer gehabt!", ruft eine im Film einmal wütend.
Ihre kindlichen Erinnerungen verklärend, emotional beschädigt vom
unverständlichen Verlust, halten sie ihre Scheuklappen so grotesk und
unbelehrbar fest, dass dieser Film zu einem Meilenstein der Erkenntnis wurde:
Was Ludin hier zeigte, war dieser unerschütterliche, aggressive deutsche
Selbstbetrug allen Fakten zum Trotz, der, als die Judenvernichtung in vollem
Gange war, ganz genauso funktioniert haben muss.
Erika, die älteste Tochter, die als süßes Mädchen im weißen Kleid Hitler die
Hand geben durfte, fehlte in diesem Film bereits. Sie war nicht lange nach dem
Tod ihrer Mutter einem Unfall erlegen, Folge ihres jahrzehntelangen Alkoholismus.
Über sie hat nun ihre Tochter Alexandra Senfft das Buch "Schweigen tut weh"
geschrieben. Es ist der anrührende Versuch einer Ehrenrettung.
Denn Erika war das schwarze Schaf der Familie. Aufbrausend, fordernd, autoritär,
selbstmitleidig, dabei unersättlich nach Liebe und Zuwendung, hat diese Älteste
es Mutter und Geschwistern sehr schwer gemacht, ganz zu schweigen von dem, was
sie mit ihrer Trunksucht später ihren Kindern angetan hat.
Indirekt auch die Tochter auf dem Gewissen
Als Ursprung dieses Wütens gegen sich selbst, als Grund des "Selbstmords auf
Raten" ihrer Mutter identifiziert Alexandra Senfft den Schock über die
Hinrichtung ihre Vaters und den verlogenen Umgang der Familie: "Mein Großvater
hat indirekt auch meine Mutter auf dem Gewissen, denn sie hat seine Schuld
unbewusst übernommen, ja fast internalisiert und damit nicht leben können… meine
Großmutter hat ihre älteste Tochter einem Mythos geopfert, dem Mythos des
schuldfreien, wahrhaftigen und stets anständigen Ehemanns".
Während es Erikas Schwestern offenbar leichter fiel, die Fabel vom guten Nazi
auch mit ihren Ehepartnern weiterzuspinnen, heiratete Erika den Juristen
Heinrich Senfft und bekam Zutritt zur linksliberalen Hamburger Gesellschaft -
man verkehrte mit Willy und Rut Brandt, mit den Augsteins und anderen. So muss
Erika Senfft zwar irgendwann geschwant haben, was für ein Mann ihr Vater
wirklich war - doch für historische Recherche, gar für die Konfrontation mit
ihrer Mutter war sie zu schwach.
Sie hätte eine Therapie gebraucht, mutmaßt ihre Tochter, wenn es den richtigen
Therapeuten damals überhaupt gegeben hätte. Recherche und offene Konfrontation:
Das gelang ja selbst Malte, der sich an den Vater kaum erinnert, erst nach dem
Tod der Mutter Erla, das gelingt Erikas Tochter, der Enkelin des Hanns Ludin,
nachdem der Onkel mit seinem Film den Weg bereitet hat.
"Schweigen
tut weh" ist trotz einiger Längen ein kluges und sensibles Buch, das seiner
Autorin einiges abverlangt haben muss. Seine ganze Wirkung aber erreicht es wohl
nur in Verbindung mit Malte Ludins Film. Der Name Ludin jedenfalls, so scheint
es, wird langsam, wegen oder gerade aufgrund der ungeheuren destruktiven
Verdrängungsleistung einiger Familienmitglieder, zur deutschen Chiffre für späte
Aufarbeitung, die die weitreichenden Schäden der Verleugnung nur umso klarer ans
Licht bringt.
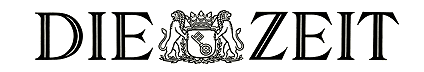
DIE ZEIT, 10.05.2007 Nr. 20
Christina von Braun und Alexandra Senfft steigen ins Archiv der Gefühle und schreiben Familiengeschichte.
Christina von Braun: Stille Post: Eine andere Familiengeschichte; Propyläen Verlag, 2007; 416 S., 22,- €
Alexandra Senfft: Schweigen tut weh: Eine deutsche Familiengeschichte; Claassen Verlag, 2007; 351 S., 19,95 €
Fotos sind trügerisch. Diese Familienfotos zeigen ansehnliche Frauen, gefällig in Pose, häufig mit Mann, nicht selten ganz in Weiß, eine beugt sich an ihrem Frühstückstisch strahlend vor, um ihre Tochter in dem Hochstühlchen zu beäugen. Idylle auf Balkon, inklusive Oma.
Eine Frau steht in ihrem weißen Kostüm neben einer Limousine, vor ihr das Mädchen mit den Affenschaukeln. Gattin vor Ausfahrt, Hakenkreuz am Wagen. Eine junge Frau im schimmernden Seidenmantel, dazu die passende Pillbox, ihr Mann balanciert den Regenschirm über ihr und dem Kind, welches sie so hart am Arm packt, dass man fürchten muss, das Blumenkörbchen in der Hand des Mädchens könnte abfallen. Szenen einer Veranstaltung, die wir Familie nennen und die in endlosen Variationen gespielt wird, das allein aber wäre natürlich belanglos, Familie haben schließlich alle, als Intimbereich. Familiengeschichte als öffentliches Geschehen braucht die Ingredienzien Unglück und Geheimnis, Verstrickung in Schuld, Skandal, Sühne und Verhängnis, wird erst so Tragödie, auflagengeeignet – oder gar historisch bedeutsam, so viel behaupten jedenfalls die Autorinnen der beiden Familiengeschichten, in denen die beschriebenen Bilder zu betrachten sind. Alexandra Senfft und Christina von Braun haben sich vorgenommen, ihre Familiengeschichte zu erzählen, »eine deutsche Familiengeschichte« sei es, schreibt Alexandra Senfft, »eine andere Familiengeschichte« verspricht Christina von Braun. Geschichten, die erzählen, was die Fotos nicht zeigen, die wahre Geschichte sozusagen. Aber was ist schon wahr?
Ist Leben überhaupt erzählbar, wenn ja, wer dirigiert die Handlung?
Wie tief kann man in das Leben anderer eintauchen, was hat man selbst darin verloren, was wäre darin zu finden, was andere angeht? Ist Leben überhaupt erzählbar, und wenn ja, wer dirigiert die Handlung? Das Schicksal? Oder die Protagonisten? Sind es vielleicht die, die erzählen, mit ihrem eigenen Interesse, hier zum Beispiel zwei Töchter?
Christina von Braun und Alexandra Senfft sind keine naiven Frauen. Die eine, Jahrgang 1944, Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin und davor in Paris und Amerika lebend, die andere, rund zwanzig Jahre jünger, Journalistin, auch für die UN vor Ort in Gaza und im Westjordanland als Beobachterin und Pressesprecherin. Beide Frauen der Öffentlichkeit also, übrigens auch selbst Mütter und nun eintauchend in Privates, das sie hier öffentlich stellen. Christina von Braun hat sich vorgenommen, die Geschichte ihrer Großmutter zu erforschen, Mutter ihrer Mutter, es ist die strategische Suche nach einer ihr Unbekannten, einer tüchtigen Kriegerwitwe des Ersten Weltkriegs, die drei Monate nach Christinas Geburt starb, Herzstillstand im Frauengefängnis Berlin. Wie bitte? Wie durch ein Dickicht schlägt sich die Enkelin zu ihr, durch Schweigen. Alexandra Senfft dagegen hat sich aufgemacht, eine Frau auf Distanz zu bringen, sich zu retten aus der Verstrickung mit einer unglücklichen Mutter, selbstzerstörerisch bis zu ihrem Tod durch Verbrühung bei einem Sturz in kochend heißes Badewasser. Senfft ringt mit diesem Erbe wie mit Tentakeln.
Hildegard also und Hilde, Erla und Eri. Es ist eine Frauengeschichte
Auf den ersten Blick also gegensätzliche Erzählimpulse. Aber es gibt überraschende Parallelen. Zwischen Großmutter Hildegard und deren Enkelin Christina gewinnt im Laufe der Erzählung eine andere Frau Gestalt, die Mutter Hilde, Ehefrau des Diplomaten Sigismund von Braun, eine kapriziöse, verführerische, in die eigene Destruktion taumelnde Frau, geradezu ein Alter Ego von Erika, Alexandras Mutter. Und hinter Eri taucht im Laufe des Buches eine zweite Kriegerwitwe auf, die tüchtige Erla, Großmutter der Autorin, Mutter von sechs Kindern und Witwe von Hanns Ludin, der Statthalter des Führers in der Slowakei war und Verantwortlicher für die Deportation und Ermordung von 70000 Juden und der 1947 gehenkt wurde.
Hildegard also und Hilde und dann Erla und Eri und dazu die Töchter, die diese Leben erforschen, sie schreiben Frauengeschichte als eine Girlande, die sich von Frau zu Frau durch die Generationen rankt, in denen es nur so wimmelt von bedeutenden Männern, die Titel tragen wie Reichsminister, Legationssekretär, Reichspressechef, SA Obergruppenführer, Gesandter 1. Klasse, aber hier einmal nicht die Hauptrolle spielen. Zwei Bücher spiegeln sich mit ähnlichem Personal und mal gegenläufigen und dann sich annähernden Erzählbewegungen. Es gibt sogar eine Berührung der beiden Erzählverläufe, ausgerechnet im Vatikan.
Der Vatikan hatte gegen die Aussiedlung der Juden aus der Slowakei protestiert, die unter Senffts Großvater organisiert wird, angeblich in Unwissenheit, der Diplomat Albrecht von Kessel aber wird bei ihr zitiert mit den Worten, alle höheren Beamten des Auswärtigen Amtes hätten seit 1941 gewusst, »dass die Juden planmäßig auf die eine oder andere Weise physisch ausgerottet werden sollen«. Kessel nun ist ein Freund der Brauns, er war wie sie im letzten Kriegsjahr im Vatikan beherbergt, wo Sigismund wegen vorsichtigen Einschreitens gegen die Deportationen italienischer Juden gut gelitten war. Kessel wird die Taufrede für Christina halten, am 20. Juli 1944, und auch hier gibt es einen mörderischen Hintergrund. Ein Monat zuvor war auf London die erste V2 niedergegangen, jene Wunderwaffe, die der Onkel Wernher von Braun entwickelt hatte und bei deren Produktion in den Stollen von Dora etwa 20000 Menschen umkommen sollten. Aber die Männer sind, wie gesagt, in diesen Büchern eher Randfiguren, weil Frauen der Familie ins Zentrum der Betrachtung rücken, insbesondere die sich so qualvoll windenden Lebensläufe der Mütter erscheinen unter der Erzählperspektive ihrer Töchter als »Kollateralschäden« einer historischen Situation, Erbe und zugleich Ausdruck von erzwungener Verdrängung und angstvoller Leugnung familiärer Schuld: Schweigen tut weh, so der eine Titel, Stille Post der andere, der so etwas wie ein neues Verfahren historischer Quellennutzung beschreibt. Man möchte sagen, ein weibliches Verfahren, und nicht ganz freiwillig gewählt.
Vermutungen, Deutungen, Fragen an das Ich – eine gewagte Erzählweise
Schon immer und auch lange nachdem sie ihr eigenes Leben geführt habe, schreibt von Braun, »hatte ich nach Begegnungen mit meiner Mutter oft mit schwierigen Zuständen zu kämpfen, die bis zu Übelkeit und Erbrechen führen konnten«. Ach, Mutter, ewiger Ohrwurm in Moll, Stoff für psychologische Tiefenforschung, Liebeslyrik, Hasstiraden. Mit ihren Wutanfällen, den Depressionen, dem Verschweigen habe sich in ihrer Mutter etwas ausdrücken wollen, das Wissen um die jüdischen Vorfahren zum Beispiel, die Ablehnung ihrer Mutter, die sich einer kommunistischen Widerstandsgruppe angenähert habe, was dann zu Verhaftung und Tod geführt habe, es habe an ihr, Christina, gelegen, diese »stille Post« aufzunehmen und das Ungesagte auszudrücken, formuliert Braun. Auch Senfft versucht sich in der Deutung von fleischgewordenem Unglück, noch in den eigenen körperlichen Beschwerden als Teenager findet sie eine Botschaft der Mutter, ja Botschaft ist selbst noch Stille, entstanden aus unterdrückten Fragen nach unsagbarer Schuld des so schrecklich geliebten Vaters Ludin. »Was sind die Kanäle der ›Stillen Post‹? Ich vermute, Ideen und Gefühle von Hilde waren die Mittler, auch wenn sie oft nur im Schweigen ihren Ausdruck fanden«, schreibt Braun.
Vermutungen also, Deutungen. Spekulationen, Selbstbefragung. Das ist gewagt als Erzählweise, gerade weil sie ja auf historische Zusammenhänge zielt. Und nicht unmodisch. Dass Fiktion im Gewand des Sachbuchs daherkommt ist heute ein Bestseller-Kalkül. Wie so etwas schiefgehen kann, liest man mit Grausen in der Biografie der Familie Jacobs, in der eine in ästhetischer und auch sonstiger Hinsicht ahnungslose Schreiberin ihr unbekanntes Terrain zukitscht, dass daraus nur ein Bestseller werden kann (Louise Jacobs: Café Heimat. Die Geschichte meiner Familie; Ullstein Verlag, Berlin 2006). Christina von Braun aber ist natürlich Wissenschaftlerin. Eine Vermischung von Erzählebenen passiert ihr nicht. Sie sammelt ihr Material sorgsam, mühsam transkribiert sie Briefe der Mutter, auch Aufzeichnungen ihres Onkels Hans aus der Gefangenschaft, Tagebücher der Großmutter Emmy von Braun aus der Zeit der Vertreibung aus dem geliebten Schlesien. Auch Senfft quält sich durch Sütterlin. Die Bücher entstehen so durch Anschuppung verschiedener Textpartikel und bilden raue, vielfach gebrochene Oberflächen.
Da finden sich auf einer Ebene selbstquälerische Eigenbeobachtungen. »Es gab in den Recherchegesprächen Momente, in denen ich angesichts der Erkenntnisse über die Rolle meines Großvaters unter Stress geriet, mir heiß wurde, die Muskeln spannten, meine Abwehr getroffen war. Ja, welche Abwehr eigentlich, frage ich mich heute: Wehrte ich mich dagegen, mit so jemandem verwandt zu sein?«, schreibt Alexandra Senfft. Und Braun artikuliert ihre Sehnsucht nach einem Rollenmodell, indem sie gleich das ganze Buch in die Form eines Briefromans zwängt. »Liebe Großmutter«, ruft sie immer wieder in Richtung einer Toten, eine mühsame Klammer für so viel Material und die Sehnsucht, in der Toten jenseits der Mutter ein Rollenmodell zu entdecken für geistige Unabhängigkeit.
Es finden sich in diesen Büchern Figuren von großer Überzeugungskraft in einem historischen Zusammenhang, der so detailgenau noch nicht beleuchtet war, was fesselnde Lektüre ausmacht. Emmy von Braun beispielsweise, aus alter ostelbischer Familie, literarisch hochgebildet, in vier oder fünf Fremdsprachen flüssig, beschenkt mit einem großen Zeichentalent. Und doch ganz ihrem Ehemann Magnus untertan und der Sorge um die Söhne, sie ist es, die Wernher Peenemünde als kommoden Standort für die Raketenforschung andienen wird. Ihre Tagebücher über die Vertreibung wird sie an ihren Mann Magnus abtreten, als Material für seine Memoiren – und werden nun von der Enkelin geoutet.
Erla, Großmutter von Alexandra Senfft, feinsinnige Tochter eines Beamten, als junge Ehefrau und hochschwanger von ihrem Gatten Ludin gewohnheitsmäßig betrogen, findet sich Jahre später nach der Verhaftung ihres Mannes auf einem süddeutschen Gutshof wieder mit Vieh und Mägden, Knechten und den sechs Kindern, sie wird vor ihnen das Andenken ihres Mannes hochhalten und von unbändiger Tatkraft sein.
In den Tagebüchern entfalten sich Widersprüche, die bis heute irritieren
Um solche Gestalten herum entfaltet sich eine Welt der Widersprüche, in denen man noch die Ursache heutiger Befangenheit erahnen kann. Schwer erträglich die Ermahnungen, die Erlas Mann, der Kriegsverbrecher, an seine Tochter Eri schickt: »Handle in Taten und Worten immer so, dass du Taten und Worte jederzeit vor dir und, wenn es sein muss, vor den Menschen verantworten kannst.« Höflichkeit, natürlich auch immer die »Härte gegen sich selbst«, wo hatte man das noch neulich wieder so eifernd gehört? Und bei Brauns auf ihrem schlesischen Gut wird auch noch nach Kriegsende, als die Gräuel der Deutschen unabweisbar sind, der Dünkel der »Kulturnation« ausgespielt gegenüber denjenigen, die das Abschlachten überlebten, noch heute spürbar im Gestus der Überheblichkeit, der sich ausgerechnet in intellektuellen Kreisen verfestigt hat und Besuchern des Landes immer wieder ganz erstaunlich ist.
Weniger überzeugend aber sind die Familiengeschichten, wenn die Autorinnen zu dem kommen, was sie für ihre Töchteraufgabe halten – in der Entfaltung der mütterlichen Biografien. Da sind sie auf weichem Terrain. Da beschwört Senfft eine Mutter mit »lebhaften Augen, hinter denen sich eine tiefe Sehnsucht und Traurigkeit verbergen«. Oje, so schreibt sie sonst glücklicherweise nicht: »Es ist diese verzweifelte Vatersuche im Gewand der mondänen Femme fatale, eine zerbrechliche Seele in scharfer Hülle.« Und Christina von Braun müht sich vergeblich mit ihrer These von der stillen Frauenpost. Tatsache ist – das Erbe der Großmutter Hildegard, ihre Unerschrockenheit, die Selbstständigkeit im Denken, die Anerkennung der jüdischen Familienverbindungen, das hat sich ausgerechnet über ihren Sohn Hans tradiert, der in Australien lebte, glücklich mit seiner jüdischen Frau. Unerklärlich, warum Hildegards Vermächtnis nicht auf Hildegards Tochter Hilde überspringt, die anders als Christina in ihrer Jugend mit Erla ein großes Rollenmodell vor Augen hatte, sich aber zu einem traditionellen Leben als Ehefrau und Mutter entschloss, aus dem sie dann in Eskapaden auszubrechen versuchte, auch darin Senffts Mutter Eri so fatal ähnlich.
Wahrscheinlich ist, dass Braun auch eine Tochter ihrer Zeit ist, unzweifelhaft aber eine der wenigen weiblichen Intellektuellen in Deutschland, die, angeregt durch den geistigen Aufbruch der sechziger Jahre, sich so entfalten konnte, dass sie heute ihrerseits als Rollenmodell dienen kann. Keinesfalls ausgeschlossen übrigens, dass auch einige der Leiden der Töchter sich nicht unbedingt auf die Mütter zurückzuführen lassen. So die Schwierigkeiten, mit denen die Schülerin Senfft in ihrem Internat kämpft, Selbstzweifel und Figurprobleme, mit denen schlagen sich nicht wenige in den mühsamen Jahren des Aufwachsens herum. Warum sich auch in dieser Familie das Vorbild der tüchtigen Kriegerwitwe Erla nicht auf die Tochter Eri übertrug? Manchmal gibt es keine einfachen Antworten.
Eri war wohl schon vor dem Tod des Vaters ein schwieriges Kind und blieb so, trotz großer Bemühungen der Familie, der Lehrer, der Freunde. Die Schule in Salem, die unermüdlichen Briefe, Pakete der Mutter, Hilfen der Freunde – alles vergeblich. Die Fokussierung auf die Schuld des Vaters Ludin erscheint zu eng, ja geradezu traditionell, so wie Senfft andersherum noch die eigene Einsamkeit der Mutter anlastet, als sei es selbstverständlich, wenn Väter hinter Akten verschwinden. Und keine Fragen an das Milieu der Hamburger Anwaltsfamilie, in einer arrivierten Gesellschaft, die für Weitherzigkeit nicht bekannt ist, ein merkwürdiger weißer Fleck in der Argumentation, wie übrigens auch Braun keine Fragen an den Onkel Wernher hat. Wenn aber Eris Schicksal vielleicht nicht nur ein historisch erzwungenes ist, sondern auch ein individuell zu verantwortendes, dann taucht die Frage auf, ob die Veröffentlichung notwendig war oder vielleicht nur indiskret. Es gibt Passagen, vor denen man Eri schützen möchte. Es gibt Momente, in denen man beide Töchter fragen möchte, woher sie das Recht nehmen, ihren Müttern so nahe zu treten – und ihr Intimstes bloßzustellen.
Leben muss übrigens ja nicht gelingen. Auch wenn die Sehnsucht danach geht, die Geschichte des Lebens ohne Einbrüche zu gestalten, auf dass sie sich runde. Für jeden Menschen mag es, unter vielen anderen Bedingungen, so etwas geben, was man die Unwägbarkeit des Schicksals nennen könnte. Ein anderes Wort dafür wäre Charakter oder, gerade unter feministischen Erwägungen – Freiheit.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
11-4-2007
Auf der Spur des Verdrängten
Zwei Autorinnen erforschen die eigene, oft verschwiegene Familiengeschichte - und entdecken mehr als Privates
VON ANTJE SCHRUPP
Christina von Braun: Stille Post. Eine andere Familiengeschichte.
Propyläen Verlag, Berlin 2007, 415 Seiten, 22 Euro.
Alexandra Senfft: Schweigen tut weh. Eine deutsche Familiengeschichte.
Claassen Verlag, Berlin 2007, 351 Seiten, 19,95 Euro.
"Es gibt eine
Form von Hinterlassenschaft, die man als unerledigte Aufträge, unabgeschlossene
Dossiers bezeichnen könnte", schreibt Christina von Braun in der Einleitung
ihres Buchs Stille Post. "Ich bin immer mehr zu der Erkenntnis gelangt,
dass die Gesellschaft einen Gutteil ihrer Erinnerungen dieser Stillen Post
anvertraut, vielleicht sogar die wichtigsten: all das, was verschwiegen wird,
aber nicht verloren gehen darf."
Zwei Frauen begeben sich in aktuellen Veröffentlichungen auf die Spur dieser
Stillen Post in ihrer eigenen Familiengeschichte, die gewissermaßen parallel
zu "der Geschichte" verläuft, der offiziellen, in den Geschichtsbüchern
verzeichneten.
Von Schweigen und Andeutungen ist hier die Rede, von verklausulierten
Botschaften und Tabus, von Verdrängtem und Tradiertem. Und es zeigt sich, dass
nicht nur die privaten Lebensgeschichten stark von "der Geschichte" geprägt sind,
sondern dass auch andersherum die Bearbeitung des Persönlichen unverzichtbar ist
für das Verständnis dessen, was politisch in den vergangenen drei Generationen
in Deutschland geschehen ist.
Vermutlich ist es kein Zufall, dass sowohl die
Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun als auch die Journalistin Alexandra
Senfft dies anhand einer weiblichen Genealogie tun.
Obwohl sie verschiedenen Generationen angehören - Christina von Braun ist 1944,
Alexandra Senfft 1961 geboren -, weisen ihre Familiengeschichten erstaunliche
Parallelen auf: Im Zentrum steht in beiden Fällen die Großmutter, bei beiden ist
der Zugang zu deren Erbe geprägt durch eine Mutter, deren persönliches Leid von
unglücklicher Liebessehnsucht und Depressionen bis hin zu Suizidversuchen
gekennzeichnet ist.
Und in beiden
Fällen gelingt es der Enkelin erst nach dem Tod der Mutter, sich auf die Spur
des familiären Erbes zu begeben.
Hildegard Margis, die Großmutter von Brauns, war eine tatkräftige Frau, die nach
dem frühen Tod ihres Manns im Ersten Weltkrieg als erfolgreiche Unternehmerin
für sich und ihre beiden Kinder sorgte. Sie hatte fortschrittliche,
emanzipatorische Ideen, brachte Sohn Paul rechtzeitig in London in Sicherheit
und unterstützte als frühe Gegnerin des Nationalsozialismus den kommunistischen
Widerstand. 1944 starb sie im Gestapo-Gefängnis.
Ihre jüdische Herkunft blieb lange Familiengeheimnis, auch deshalb, weil Tochter
Hilde 1940 den Freiherrn Sigismund von Braun heiratete: einen Diplomaten des
Reichs zuerst in Afrika, dann im Vatikan, Bruder des berühmten Raketenbauers
Wernher von Braun, auf dessen Erfindungen sich gegen Kriegsende die Hoffnungen
der deutschen Abwehr richteten. Auch auf die Spuren der Stillen Post
dieser väterlichen Familie begibt sich von Braun, vorwiegend anhand des
Tagebuchs der Großmutter Emmy, das dramatisch die Vertreibung vom Landgut in
Schlesien schildert, ohne das in deutschem Namen zuvor begangene Unrecht auch
nur zu thematisieren.
Hierin ähnelt Emmy von Braun Erla Ludin, der Großmutter von Alexandra Senfft.
Sie ist die Witwe von Hanns Ludin, der ein überzeugter Nationalsozialist und als
Reichsgesandter in Slowenien an der Deportation von zehntausenden Jüdinnen und
Juden beteiligt war. 1947 wurde er als Kriegsverbrecher hingerichtet - ein
Urteil, dessen Rechtmäßigkeit Erla Ludin zeitlebens bestritt. Für sie war der
verstorbene Ehemann und Vater ihrer sechs Kinder zwar "national", aber kein
Verbrecher - eine Sichtweise, die in der Familie teilweise bis heute
vorherrschend blieb. Erst kürzlich hat der jüngste Sohn, Malte Ludin, diese
Verdrängungsgeschichte in seinem Film 2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß
dokumentiert.
"Untergründige Kanäle"
Inwiefern diese dramatischen Zeitläufe sich in der weiblichen Familiengenealogie
niedergeschlagen haben, obwohl sie praktisch nie besprochen und reflektiert
wurden, ist Gegenstand der Spurensuche in beiden Büchern. Das deutlich
interessantere ist dabei das von Christina von Braun, was nur zum Teil daran
liegt, dass die Geschichte ihrer Familie komplexer, widersprüchlicher, von mehr
Personen geprägt und ereignisreicher war.
Die besondere Qualität von Stille Post liegt vielmehr darin, dass von
Braun ihre Idee eines über "untergründige Kanäle" weitergegebenen "psychischen
Wissens" auf eine gleichzeitig persönliche wie auch analytische Weise verfolgt.
Sie erzählt, interpretiert und wertet nicht einfach, sondern entwickelt anhand
des Geschilderten eine innovative Methode zum Verständnis von Geschichte. Sie
zeigt nämlich, wie aus vielen unterschiedlichen und verstreuten Materialien ein
komplexes Puzzle entstehen kann, wenn die Autorin Verknüpfungen herstellt, die
nur sie selbst - als Empfängerin der Stillen Post - finden kann.
Christina von Braun wollte "einen distanzierten Blick auf die Vorgänge in meinem
Kopf und meinen Gefühlen" werfen, wie sie schreibt, und das ist ihr gelungen. Es
ist genau diese Distanz, die dafür sorgt, dass bei ihr die Veröffentlichung
höchst intimer Dokumente wie Tagebücher oder Briefe niemals voyeuristisch wird.
Ein Eindruck, der sich beim Lesen von Alexandra Senffts Buch hingegen durchaus
aufdrängt. Dass das psychische Leiden ihrer Mutter eine direkte Folge
großmütterlicher Verdrängungsschuld ist, ist sicher zutreffend, wenn auch
vielleicht allzu monokausal - die für erlebnishungrige Frauen unerträglichen
Geschlechterrollen der fünfziger und sechziger Jahre werden schon auch eine
Rolle gespielt haben. Bei Senffts oft schonungslosen und unnötig detailreichen
Schilderungen der mütterlichen Verfehlungen, ihrer Liebesaffären, Krankheiten
und ihres mangelnden Verantwortungsbewusstseins drängt sich der Eindruck einer
töchterlichen Abrechnung mit der verstorbenen Mutter auf.
Wo es Christina von Braun darum geht, auf eine neue Weise zu verstehen, ist
Alexandra Senfft ganz mit der Klärung der moralischen Schuldfrage beschäftigt -
was für die außen stehende Leserin ungleich weniger interessant ist.
![]()
21-3-2007
Verdrängung ist die sicherste Form der Erinnerung
„Stille Post”: Christina von Braun erzählt weibliche Familiengeschichte nicht als Panorama, sondern als vorsichtige Ausleuchtung von Lebensfragmenten
CHRISTINA VON BRAUN: Stille Post. Eine andere Familiengeschichte. Propyläen Verlag, Berlin 2007. 416 S., 22 Euro.
Tagebuchautoren schreiben sich durch ihre Aufzeichnungen wie durch einen winzigen Stollen im riesigen Bergwerk Zeit. Ihre literarische Kraft beziehen Tagebücher gerade aus dieser Ameisenperspektive, daraus, dass der, der da schreibt, nie weiß, was kommt. Im Rückblick geschriebene Memoiren hingegen sind gerade deshalb oft so viel schwächer als Tagebücher, weil ihre Autoren ihr Material von Anfang an überblicken und fast zwangsweise versuchen, die jeweils erzählte, kontingente Geschichte mit der offiziellen Geschichte zu versöhnen, rückblickend aus einer Art sinnstiftenden Zentralperspektive das ganze Leben sinnfällig zusammenzurücken.
So befällt einen erstmal Unbehagen, wenn das Buch „Stille Post” im Klappentext damit beworben wird, Christina von Braun füge all die darin aus Tagebüchern und mündlichen Erinnerungen skizzierten Biographien „wie ein Puzzle zu einem faszinierenden Gesamtbild” zusammen. Genau das tut sie nicht, man hält am Ende ihrer Familiengeschichte, in deren Mittelpunkt sie ihre Großmutter und deren Tochter, also ihre eigene Mutter, stellt, kein Panorama in Händen, sondern Lebensfragmente, deren Figuren einem gerade deshalb näherkommen, weil man sie oft nicht versteht, vieles verschattet bleibt, als würden ihre Silhouetten von dunklen Fragezeichen umgrenzt.
„Stille Post”, der Titel und die zentrale Metapher des Werkes, umreißt dessen freudsche Vorannahme: Es gibt die offizielle, meist von Männern geschriebene Geschichte. Und es gibt, zumal in Familien und unter Frauen, das Nichtgesagte, aktiv Vergessene, Ausgeblendete, das sich viel wirkmächtiger in den Familienmitgliedern einnistet als alles Gesagte. So schreibt von Braun in einem ihrer Briefe an die längst verstorbene Großmutter, einem der Briefe, die sie regelmäßig als introspektive Haltepunkte in die Erzählung einschiebt: „Die Verdrängung ist die sicherste Form, eine Erinnerung zu bewahren. Das galt, glaube ich, auch für Deine Tochter. Durch ihr Schweigen hat sie seltsamerweise dafür gesorgt, dass du nicht vergessen wirst.”
Von Brauns Buch ist eine Spurensuche, ein Lauschen ins Schweigen, ins Schweigen der Toten und in den Weißraum zwischen den Zeilen der Briefe, Memoiren und Tagebücher, die den Krieg, die vielen Umzüge einer Diplomatenfamilie und die Schlampigkeit des Lebens überstanden haben. Im Mittelpunkt steht Hildegard von Margis, die Großmutter der Autorin, die im Ersten Weltkrieg ihren Mann verliert und 1923 die Idee hat, eine Zeitschrift für Hausfrauen zu gründen, eine Art Stiftung Warentest, die die Vor- und Nachteile der neuesten Haushaltsgeräte erklärt. Da sie damit eine Marktlücke entdeckt – die Haushalte sind mit all den Neuerfindungen vom Toaster bis zur Backröhre schlicht überfordert –, wird sie zu einer erfolgreichen Unternehmerin, lässt ihre Angestellten Kochbücher für ihren „Frauendienst-Verlag” schreiben und wird von den politischen Parteien, die gerade erst das riesige Wählerinnenpotential der Hausfrauen entdecken, umworben.
Hildegard von Margis hat zwei Kinder, Hans, den sie kurz nach der Machtergreifung nach London schickt, von wo aus es ihn nach Australien verschlägt, und Hilde, die Mutter der Autorin, die sich in zerstörerische Liebschaften stürzt, über Jahrzehnte hin Antidepressiva nimmt und ihr Leben mit einem Roman verwechselt. Von außen betrachtet, in der Aufzählung seiner Stationen, gleicht es tatsächlich einem Abenteuerroman: kometenhafter Aufstieg der Mutter zu einer der reichsten Frauen der Weimarer Republik; ihre eigene Heirat mit dem Diplomaten Sigismund von Braun, dem Bruder von Wernher von Braun; mit ihm zusammen geht sie nach Abessinien. Nach einem Haftjahr in Kenia zu Beginn des Krieges, einem Jahr, das allerdings einem ausgedehnten britischen Cluburlaub gleicht, verbringt die Familie die letzten Kriegsjahre im Vatikan, als Teil der deutschen diplomatischen Delegation. Während Europa in Flammen versinkt, sitzt die junge Mutter dreier Kinder hinter den schweren Vorhängen ihrer vatikanischen Wohnung direkt neben dem Petersdom und hält in ihrem Tagebuch die Nickligkeiten zwischen den Familien der „Feinddiplomaten” und „Achsendiplomaten” fest.
Die Großmutter hat sich inzwischen in Berlin der kommunistischen Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe angeschlossen. Nach der „Reichskristallnacht” hatte sie, die Halbjüdin war, aber anscheinend nie daran dachte, Berlin zu verlassen, jüdischen Familien ihr Haus als Warenlager angeboten, von wo aus diese heimlich ihre Produkte weiterverkaufen konnten. Von den anderen Widerständlern wird sie wegen ihrer geradlinigen Art und ihrer Menschenkenntnis „Mutti Margis” genannt. Im Sommer ’44 fliegt die Gruppe auf, am 30. September 1944 stirbt Hildegard Margis im Frauengefängnis in Berlin. Ihre Tochter vermerkt am 4. Oktober schmallippig in ihrem Tagebuch: „Muttis Tod erfahren in Berlin”.
Es wäre wahrscheinlich ein Leichtes, diese Frau als anmaßend outriertes Frauenzimmer zu zeichnen. Hilde streitet in späteren Jahren die jüdische Herkunft der eigenen Mutter ab, hat stets einen Revolver im Schminktisch und sieht ihren Lebenszweck im Repräsentieren. Die Stärke dieses Buches ist aber, dass Christina von Braun nicht richtend, sondern fragend vor ihrer Mutter steht, vor ihrem Unglück, ihrer Dunkelheit. Noch heute bewahrt sie einige der hochherrschaftlichen Abendroben der Mutter auf, „wie eine Art Photoalbum, das man geerbt hat und in dem Gesichter zu sehen sind, von denen man nicht mehr weiß, wer es war.”
Christina von Braun ist selbst keine große Erzählerin. „Hans’ erstes Jahr in Australien ging zu Ende. Die Bilanz der neuen Lebensumstände war befriedigend.” Dichte, reiche Prosa sieht anders aus als solche kursorisch kahlen Sätze. Es wird so vor sich hin erzählt. Die Kunst der Berliner Kulturwissenschaftlerin und Filmemacherin liegt in der vorsichtigen Ausleuchtung, dem genauen Lesen der Erinnerungsreste und Fragmente und in ihrer Fähigkeit, die auf winzigem Raum, innerhalb einer Familie wirkenden gegenläufigen Kräfte durch die verschachtelte Erzählkomposition deutlich zu machen: die moderne, alleinstehende Großmutter und ihre konservative Tochter; die christlich-deutsch-nationale Gesinnung der Familie Braun, Sigismund von Brauns indirekte Kontakte zur Gruppe 20. Juli und das kommunistische Engagement der jüdischen Großmutter.
Befremdlich ist freilich, dass sie die Wirkmacht der Stillen Post so ausschließlich bei den Frauen verortet, finden sich doch in dem Buch selbst reihenweise Belege dafür, wie sich auch in den Taten der Söhne die Ansichten ihrer Väter und Mütter durchpausen. Dass mit der von Wernher von Braun entwickelten V2 ausgerechnet England bombardiert wurde, wirkt wie die endlich in die Tat umgesetzte Aggression, die in den Schriften seines Vaters, des deutschnationalen ostpreußischen Gutsbesitzers Magnus von Braun, schon um die Jahrhundertwende gegen den Erzfeind England zum Ausdruck kommt.
ALEX RÜHLE

21.03.2007, S. L14
Die Pistole im
Nachttisch meiner Mutter
Eine Meisterleistung: Christina von Braun erzählt ihre Familiengeschichte aus
Tochtersicht / Von Julia Encke
Christina von
Braun: "Stille Post". Eine andere Familiengeschichte. Propyläen Verlag, Berlin
2007. 416 S., geb., 22,- [Euro].
Es gibt eine Art Urszene in Christina von Brauns Buch "Stille Post", das alles
auf einmal ist, Autobiographie, Roman, Familienchronik und Geschichte der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, und das, indem es einen eigenen, bisher
unbekannten Weg einschlägt, zu den wunderbarsten Büchern dieses Frühjahrs
gehört. In dieser Szene kundschaftet Christina von Braun als Kind (das kennt
jede Tochter!) den Toilettentisch ihrer Mutter aus. Sie liebt ihre Parfums,
besonders "Quadrille" von Balenciaga. Klappt sie den Tisch auf, öffnet sich auf
der Unterseite der Tischplatte ein Spiegel, an dem sich die Mutter täglich für
die Welt herrichtet. In den kleinen Fächern daneben findet sie Haarbürsten,
Bänder, Puderdosen. Und es gibt ein Geheimfach in diesem Toilettentisch, auf das
sie bei ihren Schnüffeleien stößt. In ihm liegt eine Pistole.
Christina von Braun, heute Filmemacherin und Professorin für
Kulturwissenschaften an der Humboldt Universität, macht sich, als Kind, nicht
viel Gedanken darüber. Wahrscheinlich, denkt sie sich, haben alle Mütter
zwischen ihren Parfums und Lockenwicklern Schusswaffen herumliegen. Viele Jahre
später aber wird diese Pistole zur Protagonistin einer Spurensuche, die, über
den Lebensweg der Großmutter, die Geschichte der eigenen Mutter ergründet. Denn
der Großmutter, obwohl sie sie nie gekannt hat, fühlt sich die Autorin näher als
der Mutter, deren verhaltene Körpersprache sie lange nicht verstehen kann. Also
adressiert Christina von Braun ihr Buch, dessen Erzählung sie, gleich einem
Innehalten, immer wieder mit fiktiven Briefen unterbricht, an sie:
"Liebe Großmutter", heißt es da, "es ist schwer, etwas über die Zeit zu
erzählen, die Du erlebt hast und in der es mich überhaupt noch nicht gab. Sieh
es mir also nach, wenn ich einiges falsch berichte. So ist das mit den
Geschichten, die man nicht selbst erlebt hat. Ich bewundere sehr die Arbeit von
Historikern: Sie können ganze Biographien, Gefühle und Lebenswelten aus den
Bildern, Akten und Schriftstücken rekonstruieren, die sie finden. Aber diese
Dokumente erzählen uns nur einen Teil der Geschichte. Daneben gibt es noch so
viele andere Erzählungen, die aus all dem bestehen, was verschwiegen wurde:
Geheimnisse, Liebesgeschichten. Wer erzählt sie uns? Vielleicht
Romanschriftsteller."
"Stille Post" beansprucht deshalb nicht, ein Roman zu sein. Doch hat diese
"andere Familiengeschichte", wie das Buch im Untertitel heißt, gerade durch
diese Briefeinschübe durchaus romanhafte Züge, die nicht zuletzt auch im Projekt
selbst angelegt sind. Die Männer ihrer Familie, stellt Christina von Braun fest
- das mag nach Klischee klingen, ist hier deswegen aber nicht weniger wahr -,
haben alle Memoiren geschrieben: veröffentlichte im Fall ihres Großvaters
väterlicherseits, Magnus von Braun, der zusammen mit seiner Frau von seinem Gut
in Niederschlesien vertrieben wurde; unveröffentlichte im Fall ihres Vaters, des
Diplomaten Sigismund von Braun, und ihres Onkels Hans. Memoiren verführen dazu,
die eigene Geschichte mit "der Geschichte" in Einklang zu bringen. Sie treten
die Herrschaft über die Vergangenheit an.
Dagegen verfassten die Frauen Tagebücher. Sie schrieben aus dem "Jetzt", ohne
historische Distanz, also ohne die Möglichkeit, die Ereignisse in den weiteren
Verlauf der Geschichte einordnen zu können. Und ebendiese Perspektive ist für
das, was die Autorin vorhat, von Interesse: Sie will etwas von dem aufspüren,
was nicht in die offizielle Geschichtsschreibung eingeflossen ist - die "Stille
Post"; hinterlegte, vertrauliche, manchmal verschlüsselte Nebengeschichten, wie
es sie in jeder Familie gibt und wie sie auch in jeder Familie weitergegeben
werden - manchmal auf verschlungenen Wegen. Dass es sich dabei um eine
spezifisch "weibliche" Art der Nachrichtenkette handelt, mag allein daran
liegen, dass den Frauen die offiziellen Kanäle der Geschichte lange versperrt
blieben. So wurde die parallele Nachrichtenvermittlung zu einer weiblichen
Spezialität, ein Gebiet, auf dem Frauen es zu Meisterleitungen gebracht haben.
Christina von Brauns Buch "Stille Post" ist seinerseits eine Meisterleistung,
und das vor allem, weil inoffizielle und offizielle Familiengeschichtsschreibung
der Nazizeit sowie der Jahre danach darin so eng verwoben sind, und die Autorin
- als Erbin von Geschichten - die Briefe an die Großmutter nutzt, um ihre Fragen
zu stellen. Das betrifft, wenn auch nur am Rande, den Onkel Wernher von Braun,
unter Hitler Raketenforscher in Peenemünde, Erfinder der "Vergeltungswaffe" V2,
bei deren Produktion KZ-Häftlinge eingesetzt wurden, von denen viele starben.
Nach dem Krieg ging er nach Amerika. In einem 1960 von "This Week"
veröffentlichten Artikel schrieb er: "Neulich hielt ich eine dieser After-Dinner
Ansprachen, die für Raketenmänner im Moment unvermeidlich zu sein scheinen.
Während der darauffolgenden Fragen und Antworten stand jemand auf und sagte:
,Warum sagen Sie uns das? Waren Sie nicht beteiligt an der Entwicklung der
V2-Raketen, die im letzten Krieg auf London fielen?' Das Einzige, was ich
antworten konnte, war, dass ich eine Diktatur überlebt habe und dass ich weder
meine in Amerika geborenen Kinder noch die von anderen in einer anderen leben
lassen will. Vielleicht hätte ich sagen sollen, dass man anscheinend durch das
Fegefeuer gegangen sein muss, um den Himmel zu schätzen." Wernher, so Christina
von Braun an die Großmutter, ist nicht durchs Fegefeuer gegangen. Andere wohl.
"Kann man sich einfach das Leid, das anderen widerfahren ist, aneignen?"
Und ihre Fragen betreffen das Schicksal der aus Schlesien vertriebenen
Großeltern väterlicherseits; ein Schicksal, für das sie sich bis zum Zeitpunkt
ihrer Buchrecherchen wenig interessiert hatte - aufgrund des revanchistischen
Tons der Vertriebenenverbände vor allem. Die überlieferten Familiendokumente
jedoch verändern ihren Blick: "Beim Lesen ist mir klar geworden, was für ein
Leid hier tatsächlich erfahren wurde - so unbestreitbar es bleibt, dass die,
denen das Leid widerfuhr, auch an seiner Entstehung Anteil hatten."
Doch das alles ist noch nicht die "Stille Post". Denn diese kommt erst ins
Spiel, wo es um die Mutter geht, die das Erbe ihrer eigenen Mutter verweigert,
nicht antreten will, zu verdrängen sucht. Der Mutter-Tochter-Konflikt bestimmt
auf diese Weise die Dynamik des ganzen Buches. Hildegard Margis, Christina von
Brauns Großmutter, war in den zwanziger Jahren Frauenrechtlerin, leitete den
Hausfrauenverband, hielt gut bezahlte Vorträge, sprach im Radio zu Themen wie
"Was die Käuferin von heute wissen muss". Ihr Ehemann war im Ersten Weltkrieg
gefallen, sie war alleinerziehende Mutter. Wegen Kontakten zum kommunistischen
Widerstand wurde sie 1944 von der Gestapo verhaftet und starb im Gefängnis. Sie
war "Halbjüdin", brachte ihren Sohn ins Ausland, kehrte - unfassbarerweise -
aber nach Deutschland zurück.
Christina von Braun gegenüber erwähnte ihre Mutter diese jüdische Herkunft nie.
Selbst als die Autorin sie, sehr spät, durch ihren Onkel in Erfahrung bringt,
weigert sie sich, diese Frage zu thematisieren. Sie wollte dieses Wissen aus
ihrer Erinnerung tilgen, ihre eigene jüdische Identität "vergessen", vielleicht
auch, weil der Antisemitismus in der jungen Bundesrepublik noch zu tief
verwurzelt war. Die Verweigerung, das Schweigen aber hat eine eigene
Körpersprache. Es ist die Sprache der "Stillen Post", die sich auch in
Krankheitssymptomen artikulierte, in Depressionen und Suizidversuchen, die zu
der im Toilettentisch aufbewahrten Pistole zurückführen. Indem Christina von
Braun diese Sprache zu entschlüsseln versucht, tritt sie das Erbe der Großmutter
an.
Und vielleicht liegt darin auch ein großer Trost: Wenn die Überlebenden des
Nationalsozialismus eines Tages gestorben sind, wird es, neben Akten und
Dokumenten, immer noch auch diesen Schatz eines psychischen familiären Wissens
geben, das sich über untergründige Kanäle mitteilt. Es ist ein vollkommen
"unwissenschaftliches" Wissen - und doch gibt es keine Wissenschaft, die nicht
von diesen geheimen, indirekten Botschaften leben würde. Christina von Braun
führt uns vor, wie man mit dem ganz eigenen Alphabet dieser Sprache umgeht. Man
wüsste am liebsten jetzt schon, was ihre Tochter dazu sagt.