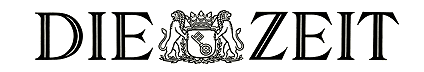
16-2-2005
António Lobo Antunes
(n. 1942)
António Lobo Antunes na Alemanha
|
| Originel | Übersetzung |
|
Memória de Elefante (Romance, 1979) Os Cus de Judas (Romance, 1979) Conhecimento do Inferno (Romance, 1980) Explicação dos Pássaros (Romance, 1981) Fado Alexandrino (Romance, 1983) Auto dos Danados (Romance, 1985) As Naus (Romance, 1988) Tratado das Paixões da Alma (Romance, 1990) A Ordem Natural das Coisas (Romance, 1992) A Morte de Carlos Gardel (Romance, 1994) Crónicas (Crónicas, 1995) Manual dos Inquisidores (Romance, 1996) O Esplendor de Portugal (Romance, 1997) Exortação aos crocodilos 1999
A história do hidroavião 2000
Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura 2000 Que farei quando tudo arde? 2001 Livro de crónicas 2002 Algumas crónicas 2002
Segundo livro de crónicas 2002 Apontar com o dedo o centro da Terra 2002 Boa tarde às coisas aqui de baixo 2003 Eu hei-de amar uma pedra 2004
|
Elefantengedächtnis. A. d. Portug. Der Judaskuss (*) Einblick in die Hölle Die Vögel kommen zurück (*) Fado Alexandrino Reigen der Verdammten (*) Die Rückkehr der Karavellen Die Leidenschaften der Seele (*) Die natürliche Ordnung der Dinge (*) Der Tod des Carlos Gardel Sonette an Christus Das Handbuch der Inquisitoren
Portugals strahlende Größe
Geh nicht so schnell in diese dunkle Nacht Was werd ich tun, wenn alles brennt? Buch der Chroniken
Guten Abend ihr Dinge hier unten
|
| (*) Titel erschienen bei DTV. Andere bei Luchterhand |
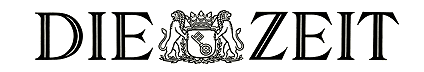
40/1997
Ein Portrait des portugiesischen Schriftstellers und Arztes Antonio Lobo Antunes
Sigrid Löffler
Jeden Herbst, sagt er, gehe es von neuem los. Seit drei Jahren immer dieselben Anrufe von Associated Press, dieselben Journalistenfragen. Sie werden als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt, was sagen Sie dazu? Er versuche, sagt er, nicht daran zu denken, rede sich ein, der Preis werde nie an ihn gehen. Alles vergeblich. Denn natürlich möchte er den Preis haben. Ein solcher Haufen Geld, steuerfrei noch dazu. Er könnte jeder seiner drei Töchter eine Wohnung in Lissabon kaufen - für den Fall, dass ihm etwas zustoße. Portugal habe nur einen einzigen Nobelpreisträger aufzuweisen, einen Mediziner, den einstigen Chef seines Vaters. Er wünschte, sagt er, dieses Ding käme auf ihn zu, solange sein Vater noch lebt. "Es wäre ein Akt der Wiedergutmachung an meiner Mutter und meinem Vater - ein Dank für alles, was sie für mich getan haben."
Mitte August wurde gemeldet, daß der international renommierte portugiesische Schriftsteller Antonio Lobo Antunes nicht zur Frankfurter Buchmesse reisen wird, die in diesem Herbst Portugal zum Schwerpunktthema hat. Er sage seine Teilnahme als Mitglied der offiziellen portugiesischen Delegation ab, ließ der Autor wissen. "Ich brauche Portugal nicht, und Portugal braucht mich nicht."
Ein Affront, offenkundig. Auch ein Akt des Hochmuts? Will sich hier ein berühmter Autor mit weniger berühmten Kollegen nicht gemein machen? Eine solche Strategie der Verweigerung kann sich nur leisten, wer sicher sein kann, daß sich sein Glanz durch Abwesenheit erhöht. Seit einigen Jahren ist dies bei Antonio Lobo Antunes der Fall. Er ist in dem Stadium angelangt, wo ein Autor seinen Ruhm organisieren muß, und sei es durch ostentative Absenz. Seine Bücher werden viel übersetzt, vor allem in Frankreich, Deutschland und Skandinavien, er ist der bekannteste portugiesische Schriftsteller der Gegenwart - neben José Saramago, seinem um zwanzig Jahre älteren Antipoden.
Seine Kunst ist es, die Portugal für die literarische Welt lesbar macht. Seine Romane entfalten präzise und sehr differenzierte Zustandsbilder der portugiesischen Gesellschaft und übersteigern sie zugleich ins höllisch Fratzenhafte, ins Apokalyptische. Was er herbeihalluziniert, wem er die Stimme gibt, das sind Portugals Dämonen, so grotesk wie fürchterlich. Seine Romane sind barocke Untergangsgeschichten vom portugiesischen Wesen und Verwesen, bizarr und melancholisch. Die triftigste Untergangsmetapher ist immer noch die Familie: Lobo Antunes erzählt das Unglück Portugals deshalb vornehmlich als Familiensaga, als Herrschafts- und Leidensgeschichte von der Gewalt der Väter und der Ohnmacht der Söhne, als Verfallsrhapsodie einer untergehenden Klasse.
Lobo Antunes stimmt den Abgesang vom lusitanischen Popanz an, er besingt den gloriosen Niedergang, die blühende Auflösung Portugals, das seine Zukunft seit langem hinter sich hat. Sein Portugal ist eine marode Phantasmagorie, geschichtsmatt und weltvergessen, "voller Furunkel aus Palästen und Harnsteinen aus kranken Kathedralen", sein Lissabon eine versunkene Stadt, über der sich die Fluten der Zeit geschlossen haben - ihre Dächer sind Korallenriffe, ihre Straßen Krebsgrotten und die Wolken über der Stadt "nichts weiter als schwimmende Algenbänke". Sein Thema ist dieser schmale Landstreifen am wäßrigen Außenrand Europas und mit dem Rücken zur Zeit: ein Land in der Flaute, wo das Leben stockt und wie betäubt auf der Stelle tritt, ein Land der Ahnungen und Alpträume, das aufs Meer und in die Vergangenheit starrt, beide unendlich größer als das Vorhandene, ein verdämmerndes Ruinenreich, trotz Massentourismus und EU-Beitritt, ein entmutigtes und entmächtigtes Land, trotz Beseitigung der Diktatur.
Die nachkoloniale Seelenfäule schwärt fort, bei den Rückkehrern aus den überseeischen Provinzen Angola und Mosambik wie bei den Veteranen des Kolonialkriegs. Die Zensur mag abgeschafft, die Pide, die politische Polizei, mag aufgelöst sein, aber der Schatten der Despotie mit ihrem Spitzel- und Folterwesen ist nicht gewichen, die Herrschaft der großen Familien-Clans dauert an, die Ordnung der alten Männer, das väterliche Prinzip, gilt nach wie vor. Immer noch geistert "der Professor" durchs Gedächtnis: Diktator Salazar, der kümmerliche lusitanische Popanz, trippelnd "mit leichten Nonnenschrittchen", an Kamillentees nippend. In der Erinnerung entscheidet er immer noch "mit seinem Spatzenfiepen" über Gedeih und Verderb, über Fátimawunder und Konzentrationslager, über Bolschewistenwahn und imperiale Weltmachtgelüste.
Bei Lobo Antunes ist alles immer Gegenwart. Die Vergangenheit ist, mit Faulkner gesprochen, nicht vergangen, die Gegenwart ist, mit Sartre gesprochen, nichts als vergangene Zukunft. Vergangenheit und Zukunft gehen auf und sind verschlungen in einer allumfassenden Gegenwärtigkeit. Alles dauert, dauert an und dauert fort. In seinen Romanen geschieht alles simultan. Vielmehr: Alles geschieht simultan nicht. Da im Portugal des Lobo Antunes alles am toten Punkt stagniert, bewirkt der allgemeine Stillstand die Gleichzeitigkeit aller Vorgänge. Das zeitliche Nacheinander ist aufgehoben in der Synchronität aller Ereignisse. Wo nichts geschieht, geschieht alles zugleich. Das Nacheinander des epischen Erzählens wird von diesem Autor ersetzt durch ein labyrinthisches Verschränkungs- und Parallelisierungsspiel, das alle Zeitebenen überblendet und unterschneidet - bis den Leser ein Schwindelgefühl totaler Gleichzeitigkeit erfaßt. Das lang anhaltende Unglück Portugals, in diesen Synchronisierungsschriften des Antonio Lobo Antunes verewigt es sich. Dieser Autor braucht Portugal, und Portugal braucht ihn.
Das Hospital Miguel Bombarda in der Rua Almeida Amaral mitten in Lissabon war früher ein Nonnenkloster und trägt den Namen eines vormaligen Chefarztes, der von einem seiner geisteskranken Patienten ermordet wurde. Das Spital wirkt freundlich und still im Spätsommerlicht, ein anmutiger Barockbau in Honiggelb. Es sieht gemütlich aus, zwangloser, als man sich eine psychiatrische Klinik vorstellt. Patienten dösen friedfertig im Vorgarten.
Der Psychiater Dr. Lobo Antunes ist in der Abteilung für Notfälle anzutreffen. Schon sein Vater war hier Chefarzt. Er selbst hat den Posten des Chefarztes geräumt, als das Schreiben ihm dafür keine Zeit mehr ließ. Nun ist er zwar nicht länger Chef, aber immer noch oft in seinem Sprechzimmer zu finden. Hier ordiniert er auch für Journalisten - auf den ersten Blick ein schroffer und verschlossener Mann, optisch eine vierschrötigere Ausgabe des Typus Yves Montand. Seine Harthörigkeit kaschiert er durch Monologisieren, aber im monologischen Sprechen wird er immer offener und freundlicher.
Auch passionierter. Wie seine Landsleute den portugiesischen Auftritt bei der Buchmesse eingefädelt hätten, sei eine Schmach und eine Peinlichkeit, sagt er. Seiner Meinung nach hätte man fünf oder sechs gute Autoren individuell nach Frankfurt schicken sollen, nicht aber dreißig im Pulk. "Es gibt keine dreißig präsentablen Schriftsteller in diesem Land. Sie werden sich blamieren. Da will ich nicht dabeisein."
In diesem grottengrünen Arztzimmer kann Lobo Antunes schreiben, da ist er unter Menschen und trotzdem ungestört. Er sagt, er möge den Spitalsgeruch und er liebe den Kontakt zwischen der Hand und dem Papier. Die Erst-, Zweit- und Drittfassungen seiner Romane entstehen alle auf Krankenhauspapier, engzeilig geschrieben mit bunten Kugelschreibern und in einer aufrecht gerundeten, braven Bubenschrift.
Ein Dutzend Romane sind es bisher, in den achtzehn Jahren zwischen "Memoria de elefante" ("Elefantengedächtnis"), dessen Übersetzung er verboten hat, weil sein Vater das Buch anfängerhaft fand, und "O manual dos inquisidores", dessen deutsche Übersetzung (von Maralde Meyer-Minnemann) soeben erschienen ist ("Das Handbuch der Inquisitoren", Luchterhand Verlag). Schreiben, sagt er, könne er überall - auf Reisen, mit Menschen ringsum, bei laufendem Fernseher ohne Ton. Er schreibe langsam und zäh, oft zwölf, fünfzehn Stunden täglich. Wenn er nicht arbeite, fühle er sich schuldig.
Er ordne seine Romane gerne in Zyklen. Zuerst drei autobiographische Romane über Kolonialkrieg, Liebe und Irrenhaus. Dann vier Romane über Portugal. Danach die Benfica-Trilogie - drei Bücher über das Villenviertel, in dem er aufgewachsen ist. Deutschsprachige Leser kennen davon "Die Leidenschaften der Seele" und "Die natürliche Ordnung der Dinge". Und jetzt sitze er an einer Tetralogie über die Macht - über die alten Eliten Portugals, die weißen Kolonialherren in Afrika, die Machthaber im Mutterland. Er sei jetzt 55 und halte sich für einen alten Mann, auch wenn er sich immer noch wie ein kleiner Junge fühle, der voller Bewunderung aufblicke zu den Großen der Literatur, zu Grass, zu Mailer, zu Ernesto Sábato. "Wenn ich noch drei, vier Bücher fertigbringe und wenn sie gut sind, dann habe ich ein Polster, um den Kopf drauf zu betten, wenn ich sterbe."
"Ich bin ein Mann aus einem schmalen, alten Land, aus einer in Häusern ertrinkenden Stadt. Ich wurde geboren und bin aufgewachsen in einer stickigen Welt aus Häkelspitzen, die Häkelarbeit der Großtante und die manuelinische Häkelarbeit der Architektur haben meinen Kopf in Filigranmuster zerlegt, mich an die Nichtigkeit von Nippes gewöhnt, kurz, sie haben meine Sinne reglementiert", berichtet der Ich-Erzähler in dem autobiographischen Roman "Der Judaskuß".
Da hat er den Schock seines Lebens schon hinter sich, die Entregelung der Sinne bereits durchgemacht, auf brutalste Weise - ein Schicksal, das er mit seinem Autor teilt. 1968 wurde Lobo Antunes vom Salazar-Regime als Militärarzt nach Angola zwangsverpflichtet. Vier Jahre Wehrdienst, davon 27 Monate am Arsch der Welt, "Os cus de Judas", im Angolakrieg, dem Vietnamkrieg des armen Mannes. 150 von den 600 Mann seines Bataillons seien gefallen, sagt Lobo Antunes, aufgerieben durch einen unsichtbaren Feind, verreckt an Malaria, Minen und Guerilla-Kugeln aus dem Hinterhalt.
Lobo Antunes selbst ist davongekommen, im "Judaskuß" beschwört er diese Reise ins Herz der Finsternis - als trunkenen Monolog eines Angolaveteranen in einer Lissaboner Bar, als fiebrige Konfession an eine unbekannte Frau, als besessenen Redeschwall eines Mannes, der seine Verzweiflung in Alkoholschwaden auflöst. So kaputt er ist, so gnadenlos rechnet er mit denen ab, die ihn kaputtgemacht und in einem absurden Krieg verheizt haben. "Der Judaskuß" hat Lobo Antunes 1979 über Nacht berühmt gemacht, aber auch notorisch. Von da an galt er in Portugal als der abgefallene Cherub des Großbürgertums und war inthronisiert als der Luzifer kommunistischer Kritiker.
"Angola hat mir politisch die Augen geöffnet", sagt Lobo Antunes heute. "Es war ein Krieg von Kindersoldaten, angeführt von Offiziersknaben. Er wurde geführt im Namen gewaltiger, stumpfsinniger Ideale - Ehre, Opfer, Vaterland. Dabei gibt es nur eine Ehre - die Ehre, am Leben zu sein."
Ehe er nach Afrika kam, habe er den Tod nicht gekannt, sagt er. Der Tod existierte nicht für ihn. In seiner Familie wurde nicht gestorben, dafür war sie zu jung. "Ich bin der älteste Sohn zweier ältester Söhne. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern zwanzig, meine Großmutter war vierzig, mein Großvater war viel jünger als ich heute, ich habe Onkel und Tanten, die nur fünf Jahre älter sind als ich."
Die Familie war jung, aber zugleich uralt. Lobo Antunes ist der Sproß einer großbürgerlich-aristokratischen Dynastie. Hohe Militärs und ein brasilianischer Kautschukgroßhändler finden sich unter seinen Vorfahren, aber auch eine deutsche Großmutter. Sein Vater, zwei seiner fünf Brüder und er selbst sind Mediziner. "Zu Hause in Benfica wurde nie über persönliche Gefühle geredet, nur über Literatur. Während des Faschismus konnte man auch nicht über Politik reden. In den Ferien las uns mein Vater jeden Tag ein, zwei Stunden lang Gedichte vor. Ich wuchs mit deutscher und englischer Literatur auf, mit Goethe und den Brontës und George Eliot."
Im Hause Lobo Antunes ist der 25. April 1974 ein Datum, an dem sich die Familiengeister scheiden. Ob die Nelken-Revolution, der Militärputsch gegen das System Salazar/Caetano, als Befreiungsschlag oder als Katastrophe anzusehen sei - in der Familie ist das strittig. Sein Vater und seine Brüder seien Linke, sagt er, die waren einverstanden mit dem Umsturz. Aber die Brüder seiner Mutter, die Schwestern seines Vaters hätten die Revolution einfach nicht zur Kenntnis genommen, hätten die Zeit angehalten und sich eingesponnen in ein imaginäres Portugal von früher. In all seinen Romanen sind solche Menschen anzutreffen, die nostalgisch einer verschwundenen Größe nachhängen: Schleiereulen der Vergangenheit, die benommen ins Heute blinzeln und sich nicht zurechtfinden im Faktenlicht.
Der Riß in der Familie geht durch Lobo Antunes hindurch und ist sein literarisches Thema: Er wütet in seinen Romanen gegen das Ancien régime, aber es läßt ihn nicht los. Er rechnet mit ihm ab, aber die Rechnung geht nie auf. Indem er es anprangert, beschwört er es ständig aufs neue. Indem er es wortgewaltig haßt, erhält er es am Leben. Die beherrschenden großen Familien der Salazar-Zeit, die Wirtschaftsbarone und Financiers, gehören ebenso zum Personal seiner Romane wie die Militärs, die verstockten imperialen Phantasten und achtlosen Menschenwürger, einschließlich ihrer Büttel und Folterknechte. Seinen neuen Roman "Das Handbuch der Inquisitoren" hat er Ernesto Melo Antunes gewidmet, seinem Hauptmann während des Angolakriegs, der einer der Mitverschwörer und Programm-Vordenker der Revolution und später Minister wurde. So ziert ein Mann, den Lobo Antunes ehrt und bewundert, die Aufschlagseite eines Romans, in dem es kaum Figuren gibt, die sich ehren und bewundern ließen.
Was für eine Familie! Was für ein Haushalt! Eben noch war der Herr Doktor gefürchteter Minister unter Salazar, Besitzer eines Landgutes in Palmela, über dem die Raben lachen, Familiendespot, Herr aller Dienstmädchen, Tyrann all seiner ehelichen und unehelichen Kinder, eben noch konnte er stolz von sich sagen, er nehme vor niemandem den Hut ab, nicht einmal vor Salazar, nicht einmal beim Rammeln des weiblichen Personals, doch jetzt liegt er im Altenheim in Alvalade, inkontinent, zahnlos und ohne Hut. Und nebenan liegt der Major und kämpft genauso mit der Bettpfanne und dem Gebiß. In einem früheren Leben war er Chef der Geheimpolizei Pide.
João, der Sohn des Ministers, sitzt an Vaters Bettkante und perlustriert die Ruinen seines Lebens. Sein Vater hatte ihn mit der Tochter einer der großen Familien verheiratet, doch für den hochmütigen Clan von Bankherren und Industriefürsten in Estoril ist dieser Schwiegersohn immer nur ein Versager gewesen, ein Tölpel, der Sohn eines politischen Parvenüs. Von der Frau ist er geschieden, und Palmela hat er verloren. Der Schwieger-Clan hat ihm das Landgut mit Trug und Drohungen abgeluchst und es in eine lukrative Feriensiedlung mit Reitställen, Swimmingpools und Golfplatz verwandelt.
Was João nicht weiß: Diese Transaktion ist eine Revanche - die kalt genossene Rache des Familien-Chefs in Estoril an Joãos Vater. Erst hat er dem Minister Isabel, die Ehefrau, abspenstig gemacht, dann raubte er ihm auch noch sein Gut.
Was nur das Personal weiß, der Chor der Statisten in diesem Herrenleben: Der mächtige Minister war bloß eine Attrappe, eine gebrochene Figur, die den Despoten nur noch schwächlich markierte, ein hilflos trauernder, verlassener Liebhaber seiner untreuen Frau. In der vornehmen Rua Castilho hat er Milá ausgehalten, ein Mädchen aus einem Kurzwarenladen, nur weil er sich einredete, sie sehe der entschwundenen Isabel ähnlich.
Was für eine triste Liebesfarce: der verblendete sugar-daddy und der Trampel Milá, der sich in Isabels konservierte Kleider und Stöckelschuhe von einst quetscht, um dem Alten sein Sehnsuchtstheater vorzuspielen, die Wunschvorstellung von der Rückkehr der jungen, liebenden Isabel.
Als "Berichte" und "Kommentare" hat Lobo Antunes seine Materialien geordnet. "Das Handbuch der Inquisitoren" gibt sich das Gepräge einer inquisitorischen Befragung. Insgesamt achtzehn Zeugen melden sich zu Wort und geben ihre Sicht der Dinge zu Protokoll, ein buntgemischtes Personal: Haushälterin, Hausmeister und Chauffeur, der Tierarzt, den der Minister kommen ließ, damit er die Köchin von seiner Bastardtochter entbinde, diese Tochter selbst, deren angolanische Ziehmutter, die Mätresse Milá und deren Mutter, schließlich die engere Familie und am Ende deren Oberhaupt selber, der morsche Patriarch und triste Autokrat. Sie alle erheben die Stimme, beharren auf ihren Leitmotiven, vermischen in Zeitsprüngen assoziativ Vergangenheit und Gegenwart, monologisieren drauflos, verbergen sich, verraten sich, trauern, zetern, höhnen, flüstern, verstummen.
Was für ein Stimmengewirr! Was für eine symphonisch durchkomponierte Stimmenordnung! Lobo Antunes gibt jedem Sprecher seine eigene Stimmlage, seinen Tonfall, sein Milieu, seine Sichtweise, seine biographische Wahrheit. Nur bei William Faulkner finden sich polyphone Stimmengeflechte von vergleichbarer Raffinesse und formaler Kühnheit. Die Wortprotokolle der Zeugen klingen bei Lobo Antunes wie Beichtreden, wie Assoziationsmaterial von der Psychiater-Couch, wie Konfessionen vor einer Letzt-Instanz, die niemand anders ist als der Leser selbst. Denn der Leser ist es, der all diese Redeschwälle kanalisiert und all diese Bewußtseinsströme zusammenführt. Er ist der Großinquisitor, für den diese inquisitorischen Befragungen veranstaltet werden. Und natürlich wird ihm von Lobo Antunes an Aufmerksamkeit, Zuwendung und Geduld einiges abverlangt. Wie man es von einem Großinquisitor eben erwarten darf.
Nie werde er ein Bestsellerautor sein, sagt Lobo Antunes in seinem Lissaboner Spitalzimmer. Das sei auch nicht sein Ehrgeiz. "Ich bin bescheiden. Ich möchte die Kunst des Romans verändern. Ich möchte eine neue, nie dagewesene Art erfinden, die Dinge auszudrücken. Wenn man dieses Ziel nicht anstrebte, hätte es keinen Sinn zu schreiben." Und dann erzählt er von seinem Freund, dem italienischen Autor Antonio Tabucchi. Den habe er gefragt, warum er seine Zeit darauf verschwende, Lobo-Antunes-Romane ins Italienische zu übersetzen, anstatt seine eigenen Bücher zu schreiben. "Weil du mehr Talent hast als ich", habe Tabucchi geantwortet.
N Z Z Online
Afrika oder die Krankheit des weissen Mannes
António Lobo Antunes: «Portugals strahlende Grösse»
Thomas Sträter
Im ersten Band seiner Tagebücher «Siebzig verweht» räumt Ernst Jünger den Eindrücken während einer Reise im kolonialen Angola der sechziger Jahre breiten Raum ein. Mag er nun Geographie, Flora und Fauna, die Menschen, auf die er trifft, zum Gegenstand seiner Betrachtungen machen, dem heutigen Leser wird schlagartig die anachronistische Realität einer Gesellschaft bewusst, die offensichtlich nur auf der Basis eines mehr oder weniger camouflierten Rassismus funktioniert. Auch Jünger muss diesen Widerspruch gespürt haben. «Was ist eigentlich ‹schwarz›?» fragt er sich. «Merkt man, dass man schwarz ist, nur, wenn man mit Weissen in Berührung kommt? Oder hat der Mensch dem Schwarz gegenüber angeborene Bedenken, wie gegen die Nacht oder gegen das Dunkle im Vergleich mit dem Licht? Warum versuchen die Neger, sich die Haare zu entkräuseln? In Amerika lebt eine Industrie davon. Wahrscheinlich empfindet die schwarze Frau den schwarzen Mann als den schöneren. Warum wird ‹Schwarzer›, ‹Neger› als Schimpfwort empfunden? [. . .] Rasse hat heute einen Hautgout bekommen.» Etwas gönnerhaft, doch wenig überzeugend schliesst er die Betrachtungen dieses Tages mit dem Bekenntnis: «Mir waren und sind die Neger angenehm.»
Nationale Hybris
Jüngers Gedanken über die Bedeutung des «Schwarzen» und der daraus sprechende rassistische Dünkel, als Angehöriger der weissen Rasse naturgegeben einer herrschenden Elite anzugehören, werfen ein erhellendes Licht auf die Spannungen im öffentlichen wie im familiären Leben der portugiesischen Kolonie vor der Unabhängigkeit, die erst durch den Sturz des portugiesischen Regimes in der Nelkenrevolution von 1974 möglich wurde. Vor diesem Hintergrund spielt sich António Lobo Antunes' neuer, in deutscher Übersetzung vorliegender Roman «Portugals strahlende Grösse» ab. Der portugiesische Erzähler greift hier wieder sein grosses Lebensthema aus «Der Judaskuss» auf, dieser bildmächtigen Beichte eines von den Grausamkeiten des Krieges traumatisierten Soldaten, mit der er international auf sich aufmerksam machte: Portugals jüngste Vergangenheit, die Salazar-Diktatur und der Krieg in den ehemaligen Kolonien in Afrika. Im allgemeinen Sprachgebrauch Portugals wurden diese Gebiete als Ultramar bezeichnet. Sinnfällig beschreibt die Metapher das lusitanische Territorium als zwei nur durch den Ozean getrennte Teile, erhebt damit gleichzeitig den unmissverständlichen, keiner weiteren Legitimation bedürfenden Besitzanspruch auf überseeische Gebiete, die die Grösse des kleinen Mutterlandes um ein Vielfaches übertreffen. Als «Helden des Meeres», die diese Eroberungen vollbracht haben, feiern sich die Portugiesen in ihrer Nationalhymne selbst, beschwören darin «Portugals strahlende Grösse», die es aufs neue mit aller Macht zu errichten gelte. Eine iberische Phantasmagorie aus Träumen von einer glorreichen Vergangenheit, von Ambitionen und Heilserwartungen, die nur darauf gewartet hat, in ihrer fatalen Wahrhaftigkeit desillusioniert zu werden. Schon im Titel von Lobo Antunes' Roman kündigt sich diese Entlarvung nationaler Hybris unmissverständlich an.
Doch weit davon entfernt, einen historischen Thesenroman vorzulegen, geht es dem nach wie vor praktizierenden Psychiater aus dem Lissabonner Grossbürgertum auch in diesem Roman weniger um die fiktionalisierte Schilderung historischer Ereignisse, gar um eine Geschichte des Kolonialkrieges in Romanform. Der Verlag erweist seinem Autor einen Bärendienst, wenn er dessen Werke auf dem Einband als «die besten Portugal-Geschichtsbücher» preisen lässt. Lobo Antunes verschafft uns dagegen einen ganz anderen Einblick, einen schwindelerregenden sprachartistischen Tour d'Horizon durch die selten befriedigten «Leidenschaften der Seele» – so auch ein früherer Romantitel –, die Neurosen und seelischen Verwüstungen, die eine fünf Jahrzehnte währende Diktatur hinterlassen hat und von denen Portugal innerlich längst nicht genesen ist; der Krieg als historisches Ereignis im fernen Afrika ist für den Arzt letztlich nur das Endstadium der Krankheit, die Agonie, auf die alle Symptome hindeuteten.
Auf den bei uns hochgelobten Roman «Das Handbuch der Inquisitoren» folgt mit diesem neuen Werk das Mittelstück einer «Trilogie der Gewalt». Mittlerweile ein Dutzend Romane bestätigen den Ruf des 1942 geborenen Lobo Antunes, einer der fruchtbarsten und literarisch ambitioniertesten zeitgenössischen Autoren – nicht nur seines Heimatlandes – zu sein. Seine letzten Werke erschienen in Abständen von nur einem Jahr. Dem Verdacht, diese eruptive Produktivität gereiche der Ausarbeitung nicht zum Vorteil, muss entschieden widersprochen werden. Was bei einem oberflächlichen Lesen von «Portugals strahlende Grösse» zuerst als chaotische Bewusstseinsströme ohne Anfang und Ende erscheinen mag – es gibt kein Inhaltsverzeichnis, das bei der Orientierung helfen könnte –, offenbart sich bei näherer Betrachtung als einem strengen kompositorischen Plan folgend. In drei Teilen, oder musikalisch gesprochen Sätzen, mit jeweils zehn Kapiteln ertönt die Polyphonie eines Stimmenquartetts: Vier Mitglieder einer portugiesischen Familie erinnern sich an ihr früheres Leben in Afrika, an die Flucht vor dem Krieg in die Heimat und ihre trostlose Existenz in Portugal. Wie schon in früheren Werken verschmelzen die Stimmen in einem kaum unterscheidbaren Gedächtnisgemenge zu einem Klang der Einsamkeit; durch die immer virtuosere Beherrschung der stilistischen Mittel gelingt es Lobo Antunes, Vergangenheit und Gegenwart in einer neuen Dimension der Gleichzeitigkeit literarisch zu gestalten – eine ästhetische Qualität, wie sie sonst nur die Malerei erreicht.
Banalität und Tragik
Carlos, der uneheliche, mit einer Schwarzen gezeugte Sohn des Portugiesen Amadeu, der als Ingenieur nach Afrika gekommen war, hat die beiden weissen Halbgeschwister und die Stiefmutter zum Weihnachtsfest in seine kleine Wohnung in Lissabon eingeladen, doch niemand wird kommen. Dieses Datum, der 24. Dezember 1995, bildet den Kristallisationspunkt, um den sich andere Momente der Suche nach der Vergangenheit gruppieren und in dem sie kulminieren. In stetem erinnerndem Monologwechsel, der erst durch den Leser die Qualität eines virtuellen Dialogs gewinnt, werden immer wieder bestimmte Themen leitmotivisch aus verschiedenen Perspektiven aufgegriffen und kommentiert. Es sind die Stimmen von Carlos, dem Mischling, dessen man sich schämt, von Rui, dem Epileptiker, und zuletzt von Clarisse, der sexuell gestörten Tochter. Unterbrochen werden ihre Erinnerungen durch die stets gegenwärtige Stimme ihrer Mutter, Isilda, der Tochter wohlhabender Farmer, die ihren Mann Amadeu eher aus Mitleid denn aus Liebe geheiratet hat.
Allesamt sind sie Existenzen von bestürzender Banalität und hoffnungsloser Tragik. Ihren monomanischen Suaden eignet durchaus ein kantabler Gestus wie von Opernarien. So ist Isilda die eigentliche Hauptperson, gewissermassen der soprano continuo, den die Stimmen ihrer Kinder im Wechselspiel zu Duetten ergänzen. Isilda, die ihrem völlig dem Alkohol verfallenen Mann nur mehr Verachtung entgegenbringt und ihm, mit dem Polizeikommandanten betrügt, erklärt einmal, was ihre Vorfahren dazu gebracht hat, die Heimat zu verlassen und das Glück im Süden des Schwarzen Erdteils zu suchen. Ihr gelingt dabei eine bündige Definition des Kolonialismus: «Mein Vater pflegte zu erklären, dass wir seit je nicht wegen des Geldes noch wegen der Macht nach Afrika gegangen seien, sondern wegen der Neger, die kein Geld und keinerlei Macht besassen und uns die Illusion von Geld und Macht verschaffen sollten.» Die Kolonisten, die sich als weisse Herren fern ihrer Heimat gerieren, sind sich ihres geringen gesellschaftlichen Ansehens in Portugal durchaus bewusst. Dort sind sie, die Ausgewanderten, in gewisser Weise die Neger der andern, die auf sie hinunterblicken. Aus dieser Erkenntnis heraus sind sie ihrer neuen Heimat Afrika in einer Hassliebe verbunden, vergleichbar der Leidenschaft des Kranken, der seine tödliche Krankheit zugleich fürchtet und herbeisehnt.
António Lobo Antunes hat auch mit diesem Roman Portugals subkutane Verfasstheit, die Zeichen seines gesellschaftlichen Verfalls analysiert, wie sie einem Beobachter offenbar werden, der sich nicht von glänzenden Oberflächen täuschen lässt. Er konfrontiert seinen Patienten mit einem besorgniserregenden Krankheitsbild. Vermutlich sähe dieser sich lieber in seinem Selbstverständnis als ein moderner, für die Zukunft bestens gerüsteter Staat bestätigt, dessen rechtzeitig zur Weltausstellung fertiggestellte, architektonisch kühne Brückenkonstruktion über den Tejo das neue Symbol seiner strahlenden Grösse darstellt. Nationalhymnen mögen von Glanz und Gloria künden; grosse Literatur, und als solche rechtfertigt dieses Meisterwerk aus Portugal den Rang seines Autors, muss den Blick in den dunklen Abgrund der menschlichen Existenz wagen.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Nicht nur für Psychiater
António Lobo Antunes bietet "Einblick in die Hölle"
Von Martin Luchsinger
António Lobo Antunes:
Einblick in die Hölle.
Roman. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann.
Luchterhand Literaturverlag, München 2003, 287 Seiten, 20 €.
![]()
Die
Hölle, heißt es am Ende von Sartres Huis clos, seien die anderen, unsere
Mitmenschen. Fegefeuer und ewiges Braten haben ausgedient, schon das Erdendasein
ist nichts als eine einzige Qual und auf ein Danach ist nicht mehr zu hoffen, so
die Quintessenz eines atheistischen Autors, der seine literarischen Szenerien
gerne im Jenseits angesiedelt hat. Einblick in die Hölle verspricht auch
Lobo Antunes. Wer seine melancholisch-opulenten Werke kennt, weiß, dass ihm
Sartres pessimistische Sicht der Dinge nicht fremd ist, wohl aber dessen
nüchterner Stil. Über 10 Romane hat der mittlerweile 61-jährige Autor bisher
veröffentlicht, und seit dem Erfolg von Handbuch der Inquisitoren im
Jahre 1997 gibt es auch für die deutschsprachige Leserschaft jedes Jahr eine
Neuerscheinung, vorzüglich übersetzt von Maralde Meyer-Minnemann. Einblick in
die Hölle, auf portugiesisch bereits 1983 erschienen, ragt aus Lobo Antunes
Schaffen in doppelter Weise heraus: Der Roman ist autobiographischer angelegt
als die übrigen Werke und markiert zugleich literarisch einen deutlichen
Einschnitt, weil Lobo Antunes zum ersten Mal die Technik der Überblendung
verschiedener Erzählstränge verwendet, die er seither zu virtuoser Meisterschaft
entwickelt hat.
1973 war Lobo Antunes als junger Militärarzt im schmutzigen, blutigen
Kolonialkrieg in Angola, eine Erfahrung, die er auch in anderen Romanen immer
wieder umkreist. Am Ende des ersten Kapitels heißt es unvermittelt: "... ich
wusste, was das war, Gefangene und ermordete Kinder, ich wusste, was das war,
das vergossene Blut und Sehnsucht und Heimweh, aber vom Einblick in die Hölle
war ich verschont geblieben." Was ist schlimmer als Krieg? Lobo Antunes, zur
Zeit der Niederschrift des Romans noch praktizierender Psychiater in einer
Klinik in Lissabon, gibt eine unmissverständliche Antwort: "Die Hölle, (...),
das sind die Lehrbücher der Psychiatrie, die Hölle ist die Erfindung der
Verrücktheit durch die Ärzte".
Was sich wie ein antipsychiatrisches Manifest liest, ist im Roman eingebettet in
den Erinnerungsstrom des Erzählers. Er befindet sich auf einer langen Autofahrt
von der Algarve nach Lissabon, wo er anderntags seinem Beruf als Psychiater
wieder nachkommen soll. Erinnerungen an die Kindheit, an den Krieg in Afrika und
an den Alltag in der psychiatrischen Anstalt gehen ineinander über, mischen sich
mit Szenen aus zwei gescheiterten Liebesbeziehungen, zärtlichen Reminiszenzen an
Autofahrten mit der Tochter Joana und pauschaler Kritik an Portugal, kurzen,
heftigen Anfällen "wütenden Mitleids (...) für sein dürres, fremdes Land".
Dieser Roman, so wird bald deutlich, erzählt nicht einfach von der Hölle, er
ist die Hölle, das qualvolle Seelenleben eines von der Routine und den
desolaten Zuständen in den Krankenhäusern erschöpften Psychiaters voller
Selbsthass: "Ich bin ein SS-Mann mit Zweifeln".
Was den Leser für ihn einnimmt, ist nicht sein analytischer Blick, sondern seine
Empfindsamkeit. Als ununterdrückbares Unbehagen verhindert sie vorbehaltlose
Anpassung; als Gefühl, nicht zu leben, sondern bloß zu überdauern, hält sie die
Sinne wach. Selbstkritik - "Was mache ich hier eigentlich?" - bleibt nicht aus,
verwandelt sich in ein depressives Gefühl von Sinnlosigkeit oder wird Anlass
exzessiver Schuldgefühle. Erinnerungen an mitverantwortete Folter und
Vergewaltigungen im Krieg, an die nachlässig-herablassende Behandlung der
Kranken und an die halbherzigen, verlogenen Reformvorhaben in der Psychiatrie
verzerren sich zu Horrorvisionen und kippen ins Surreale: krasse Bilder
kannibalistischer Anwandlungen, Gewaltszenarien von rächenden Patienten,
albtraumartige Phantasien einer Umkehrung der Positionen, die Gestalt gewordene
Angst des Irrenarztes, selbst als Irrer in die Maschinerie zu geraten.
Nur
selten gibt es eine Gegentendenz, ein momenthaftes Aufblitzen von Humor: "er
lachte über die Psychoanalytiker, die Inhaber der Wahrheit, die im Kopf der
Leute mit der Brust der Mutter und dem Penis des Vaters Schach spielen, mit der
Brust des Vaters und dem Penis der Mutter und der Brust des Penis und der Mutter
des Vaters dem Venis der Brutter und dem Pater der Mater". Spricht der Erzähler
auf der langen Fahrt immer wieder in direkter Anrede an seine abwesende Tochter,
so taucht am Ende, als er sich in seinem Elternhaus schlafen legt, aus dem
Dunkeln sein verstorbener Vater auf und zieht ihm das Laken über den Kopf "wie
ein Leichentuch". Freud lässt grüßen. Der markierten Distanz zur Theorie der
Psychoanalyse zum Trotz endet das Buch mit einer Reinszenierung des
Ödipuskomplexes.
Einblick in die Hölle ist ein radikaler Text voll destruktiver Kritik und
abgründigem Nihilismus. Einen Nutzen lässt sich daraus nicht ziehen. Der Roman
handelt von unser aller Scheitern und Weitermachen - und lässt nichts gelten
außer der Angst.
N Z Z Online
24. Juni 2003, 02:11, Neue Zürcher Zeitung
Leopold Federmair
António Lobo Antunes: Einblick in die Hölle. Roman. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand-Literaturverlag, München 2003. 287 S., Fr. 33.80.
Von einer «Tortur» der Lektüre sprechen selbst Bewunderer der Romankunst des António Lobo Antunes. Der Lohn für die Quälerei sei eine finale Befriedigung durch das «Ergebnis», das ästhetische Produkt. Und wenn man sich der Tortur nicht unterziehen will? Dann kann man die Romane trotzdem lesen, denn die erzählerische Basis, von der die Metaphern und Vergleiche abheben, um die Nerven des Lesers anzugreifen, ist solid, im poetischen Nebel immer erkennbar. Man findet, hat man sich einmal mit dem Autor gehen lassen, leicht wieder zurück.
«Am Ende des Tages leckte ich deine Haut wie die Kühe die Höhlungen der Felsen, dieses weissliche Spinnennetz, das die Sonne in konzentrischen Zeichnungen über den Bauch legt wie Teer im Ebbesand . . .» Ich lecke wie eine Kuh, die Haut ist (wie) ein Spinnennetz, und dieses wiederum wie Teermuster. Kühe lecken Felshöhlungen? Was haben schwarze Flecken im Sand mit feinem Spinngewebe zu tun? Und das alles mit dem Körper einer Frau? Gar nichts.
Oder: «Meine Spucke, mein Urin und mein Sperma schmecken nicht nach dem lauwarmen Bierschaum der Bars der Schwarzen in Harlem, der wie eine Bluesklage die Kehle hinunterrinnt . . .» Der Bierschaum rinnt und ist lauwarm? In «Einblick in die Hölle», diesem frühen Roman aus dem Jahr 1980, gibt es «unrasierte Münder», und ein Mann hinter dem Schreibtisch ist «von der Taille abwärts zerteilt»; ein zusammengesackter und gekreuzigter Schwarzer sieht aus «wie der Kadaver einer überfahrenen Katze»; das Meer hat einen «Möweneingeweidegeruch»; die Hitze «krümmte die Häuser wie Geburtstagskerzen»; die Wellen des Meeres nehmen «den durchsichtigen Farbton der Knochen junger Mädchen an, die man nach dem Liebesakt unter der Haut spürt wie die erste Helligkeit hinter den Stores bei Sonnenaufgang, wenn man Grippe hat . . .» Grippaler Liebesakt?
Jeder dieser Vergleiche führt zu mehreren solchen Fragen, wenn man sie, die Vergleiche, im herkömmlichen Sinn auffasst und nach dem tertium comparationis sucht: Was ist das Gemeinsame zwischen Wellen und Knochen? Es gibt kein Gemeinsames; Lobo Antunes' Vergleiche und Metaphern untergraben die traditionelle Poetik, oder schlichter und weniger bewundernd gesagt: Das Wie des Vergleichs ist nur ein Vorwand, um den Assoziationen des Autors freie Bahn zu verschaffen. Dieses Wie führt in die Irre, es bricht Identitäten auf, statt sie, wie in der herkömmlichen Metaphorik, erst einmal zu bilden. Lobo Antunes heterogenisiert den Stoff - Wahrnehmungen und Erinnerungen - durch die Sprache, statt die Vielfalt des Stoffes, wie es der klassische Roman, aber auch noch ein William Faulkner taten, zu homogenisieren.
Die tendenzielle Entkoppelung von Zeichen und Bezeichnetem könnte man als Merkmal einer barocken Literatur verbuchen - «barocke Untergangsvisionen» attestiert die Literaturkritikerin Sigrid Löffler dem portugiesischen Schriftsteller - oder, mit dem Verdikt eines alten Tangogotts aus dem Land der Kühe, folgendermassen abtun: «Mucha verdura, poca carne», viel Gemüse, wenig Fleisch. Denn die Erzählbasis - das Fleisch - ist immerhin noch da, zu der Autor und Leser nach jeder poetischen Expedition zurückkehren, so dass sich die Rede von Entkoppelung und Heterogenisierung gleich wieder dementiert. «Das Meer des Algarve ist aus Pappe gemacht wie die Kulissen im Theater», verrät schon der erste Satz des Buchs, und das ganze erste Romankapitel sowie ein Gutteil der folgenden sind nichts als Variationen dieser beiden Wörter, «Pappe» und «Kulisse», die man seit Jahren aus den Mündern auf- und abgeklärter kritischer Zeitgenossen hört, deren Ohren ihre eigene Desillusioniertheit gern poetisch ausstaffiert aus dem Mund eines Weltmeisterliteraten vernehmen. «Einblick in die Hölle» arbeitet mit einer Handvoll Thesen der zivilisationskritischen Linken (Deleuze, Foucault, Antipsychiatrie), die inzwischen längst zu Stereotypen geworden sind. Psychiater sind Kerkermeister, die Grenze zwischen Wahnsinn und Vernunft entspringt der Willkür der Macht, der Arzt ist der verkappte Irre und umgekehrt, Tourismus ist ein gigantisches Geschäft mit dem Schein. Und mit wilder Sprachlust zieht der Autor den Durchschnittsbürger durch den Nachmittagstee und wickelt ihn in manuelistische Häkeldecken. So viel zum Fleisch.
Dieser Roman ist, in der Reihenfolge der Erstveröffentlichungen, der dritte von Lobo Antunes und Teil seiner «autobiographischen Trilogie». Ähnlich wie der mexikanische Grossschriftsteller Carlos Fuentes, welcher ebenfalls einen von aussergewöhnlichem Talent zeugenden Erstlingsroman hingelegt hatte («Der Tod des Artemio Cruz»), liebt es der Portugiese, seine Bücher in Zyklen zusammenzustellen. Was im Grunde unnötig ist, soll vor allem auf die Ausmasse eines gewaltigen Werks verweisen. Da sich bei den deutschen Übersetzungen nun frühe und späte Titel abwechseln, kann zwar Verwirrung entstehen; muss aber nicht, denn Lobo Antunes hantiert mit einem einzigen, riesigen, ausufernden poetischen Strom, und wenn man als Leser eine Weile aussetzt, wie es auch bei der Lektüre eines Buchs geschehen kann, wird man später leicht wieder ins Treiben zurückfinden.
Der Keim von Lobo Antunes' Romankunst ist sein Erstling «Der Judaskuss», aus einer extremen, vermutlich die Persönlichkeit schwer angreifenden Erfahrung im Angola-Krieg heraus geschrieben. Die Entgrenzung der Sprache ist dort leichter mit der mitgeteilten Erfahrung in Verbindung zu bringen, das Werk insofern ästhetisch homogener als die späteren Familienromane und auch der Psychiatrieroman «Einblick in die Hölle», dessen Machart man nicht unbedingt als auf den Gegenstand bezogene Mimesis rechtfertigen muss: «Merkwürdiges, absurdes Gerede ohne Realitätszusammenhang. Er redet von Gemüse und Ochsen.» Achtung, diese selbstbezügliche, einer Sigmund-Freud-Karikatur in den Mund gelegte Äusserung ist mehrfach ironisch gebrochen!
![]()
23-6-2004

Artikel erschienen am Sa, 25. September 2004
António Lobo Antunes: Elefantengedächtnis. A. d. Portug. v. Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand, München. 205 S., 18 EUR.
Der Psychiater beschreibt sich selbst: "Sie stehen vor dem größten Höhlenforscher der Depression: Achttausend Meter ozeanische Traurigkeitstiefe, Schwärze glibbrigen Wassers ohne Leben, nur das eine oder andere sublunare Monster mit Fühlern, und all das ohne Unterseeboot, ohne Taucherausrüstung, ohne Sauerstoff, was ganz offensichtlich heißt, dass ich mich in der Agonie befinde."
Doch das ist nicht nur die Selbstdarstellung des "Helden", sondern auch die Grundperspektive des Romans "Elefantengedächtnis" von António Lobo Antunes, der jetzt endlich, 25 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung, in deutscher Sprache erscheint. Lobo Antunes hat immer wieder die Weiterverbreitung seines Debüt-Romans untersagt, weil sein Vater ihn für nicht gelungen hielt. Nun steht der Anfang am Ende einer Reihe von mittlerweile 14 Romanen, die den portugiesischen Schriftsteller weltberühmt gemacht haben. Und er legt, stark autobiografisch, die Motive offen, die ihn getrieben haben, sich in einer Art Selbstrettungs-Aktion dem Schreiben zu widmen.
Erzählt wird ein Tag im Leben eines Psychiaters in Lissabon, der sich verzweifelt dagegen zur Wehr setzt, die zerstörerischen Aspekte seines Daseins die Überhand gewinnen zu lassen. Und wie in allen folgenden Romanen von Lobo Antunes sind es die portugiesische Gesellschaft, die Erlebnisse während des Kolonialkrieges in Angola, die Familie und die gescheiterte Ehe einen simultanen Angriff auf das Glücksverständnis des Autors starten. Der Schriftsteller, 1942 in Lissabon als Sohn eines Arztes geboren, studierte gleichfalls Medizin, musste mehrere Jahre als Militärarzt in Angola Dienst tun und wurde dann Leiter der psychiatrischen Anstalt, in der schon sein Vater tätig gewesen war. Das ist der biografische Rahmen, der auch die Daten für die Hauptfigur seines Erstlingsromans bestimmt.
Die Welt, in der er lebt, lässt es von vornherein nicht zu, mit ihr Identität gewinnen zu können. Die psychiatrische Anstalt, in der der junge Arzt sich mühsam behauptet, ist in gewisser Weise ein Spiegelbild der Gesellschaft. Alle sind auf der Flucht vor der Realität, Wahnvorstellungen bestimmen die Lebensperspektiven, die Versuche, die Kranken zu heilen, sind nicht mehr als eine krampfhafte Bemühung, das Chaos nicht vollends im Zusammenbruch enden zu lassen: "In einem Irrenhaus, wo sind da die Irren? Warum schleppen wir uns hier herum, wir, die wir noch die tägliche Ausgehgenehmigung haben, wenn wöchentlich ein Schiff nach Australien fährt, wo es auch Bumerangs gibt, die nicht an ihren Ausgangspunkt zurückkehren?"
Während der Arzt vor seinen Patienten sitzt, deren Wahnvorstellungen ein getreues Spiegelbild ihrer unerfüllten Sehnsüchte sind, holen ihn die Erinnerungen ein, die er, ausgestattet mit einem Elefantengedächtnis, nicht los wird und die ihm ein gescheitertes Leben zu bestätigen scheinen: die großbürgerliche Familie, die alle sinnvollen Lebensvorstellungen mit ihren leer laufenden Ritualen beiseite wischt; die Tage in Angola mit Napalmbomben und Malariaanfällen; die gescheiterte Ehe, die trotz fortbestehender Liebe eine innere Berührung der Partner nicht zu leisten vermag - bis dass das Leben euch scheidet. Und so scheint alles in einem Zustand unerträglicher Einsamkeit zu enden, vor der der Arzt sich auf einer nicht enden wollende Flucht befindet.
Es ist ein Buch voller Zorn, voller Hass, aber auch voller skurriler Ironie mit Abstürzen in böse Grotesken. Und es endet in den Armen einer alternden Kokotte. "Er schämte sich, in Begleitung dieser zu lauten Frau gesehen zu werden, die mindestens doppelt so alt war wie er und mit einer so absurden, zugleich lächerlichen und rührenden Inszenierung gegen den Verfall und das Elend ankämpfte, dass er sich für ihre Scham schämte. Im Grunde waren sie gar nicht so unterschiedlich, in gewisser Weise waren ihre heftigen Kämpfe ganz ähnlich: Sie flohen beide vor der gleichen, unerträglichen Einsamkeit, und beide gaben sich, weil ihnen die Mittel und der Mut fehlten, kampflos der Angst vor dem Morgengrauen hin wie niedergeschlagene Käuzchen."
Aber Lobo Antunes hat doch keinen hoffnungslosen Roman geschrieben. Er braucht er wohl diese unerbittliche Reibung an einer Welt, die ihm lauter Apokalypsen beschert. Er liebt die Melancholien, die ihm Tiefe vermitteln. Und er findet auf verschlungenen Wegen dazu, sich im Schreiben vor dem letzten Absturz zu bewahren. In der literarischen Arbeit formuliert er jene Gegenbilder, die ihn dann und wann den Menschen näher bringen: "In der dunkelsten Nacht der Seele ist es immer drei Uhr morgens. Er streckte die Hand aus und liebkoste den Nacken des Dinosauriers mit ehrlicher Zärtlichkeit."
"Elefantengedächtnis ist ein Buch mit allen Stärken und Schwächen eines Debüts. Gelegentlich zerstiebt er in den funkelnden Kaskaden seiner Metaphern. Aber er ist auch in einem geradezu atemberaubenden Tempo geschrieben, dass der Leser bestürzt vor dem zersplitterten Spiegel seiner eigenen Abgründe zurückbleibt und sich dennoch zur Bewunderung für die Vielfalt des Lebens ermahnt fühlt.

18-5-2002
Von Wieland Freund
António Lobo Antunes:
Fado Alexandrino.
Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann.
Luchterhand, München. 798 S., 29,50 E.
Er könnte auch sein: eine Hemingway-Figur. Wie er die Zigarette aus dem Softpack klopft, wie der Zeigefinger seiner Rechten tastend das Hörgerät justiert, als sende es seltsame Signale. Seine Miene ist konzentriert, ein wenig angestrengt zugleich, seine Gesten sind auf seltsame Art die des alten Mannes und des Meers. "Ja, ich erinnere mich", murmelt er, die Stimme langsam, rauchig, tief, und eben hat er seine Begleiterin, die zum nächsten Termin drängte, traurig angesehen und gesagt: "Behandele mich nicht wie ein Tier." António Lobo Antunes, jetzt 60 Jahre alt, Witwer, ist erschöpft, bevor es losgeht, und wirkt erfrischt, nachdem er erzählt hat. Er kommt aus Lissabon, wo, wie er sagt, die Menschen "deinem Gesicht glauben und nicht deiner Idee".
Man kann ihn sich gut vorstellen in der Altstadt: Stühlerücken, trockene Handschläge, schnell gewechselte, nur halblaute Sätze, Getränke in kleinen Gefäßen, ein Kopfnicken von hier nach da, das letzte Ende der ersten Welt ist nicht weit. In Lissabon ist immer Abend. Nicht einfach so ist die Stadt der Sterbeort der europäischen Literatur, von Fielding bis Nooteboom reicht das, und am Kap von Sagres kommt auch im 21. Jahrhundert immer noch die Welt zum Schluss, als wartete am anderen Ende des Atlantiks kein Amerika.
Begeistert ist Antònio Lobo Antunes von jenem weltberühmten Dürer-Stich "Melencolia I", den der Besucher mitgebracht hat. Darauf zu sehen: die Allegorie der Melancholie mit Hund und Engel, Weltkugel und Waage, und aus dem geschlossenen Raum der Einsamkeit weist ein Fenster aufs Meer. So wie die Melancholie stellt man sich Antunes vor, in seinem Arbeitszimmer über Lissabon, an einem einfachen Tisch mit gesprungener Platte, den Blick auf den Totenfluss Tejo, am Rand des angefressenen Kontinents Europa. "Sehen Sie die kleinen Häuser", sagt Antunes, und sein trockener Finger weist auf winzige Details des Dürer-Stichs. "Das ist wunderbar", flüstert er. Er hat noch eine Verwandtschaft entdeckt.
Man ertrinkt bei Antunes in Details. In seinem soeben erschienen Roman "Fado Alexandrino" so wie in allen seinen Büchern, die Schöpfung und Erschöpfung zugleich sind. Mit Worten, die fast nur noch Rhythmus sind, tupft Antunes den Verfall aufs Papier: "Da bin ich wieder im Encanação-Viertel und bei den wie kariöse Zähne faulen Häuschen in der Nähe der stinkenden offenen Kiefer der Siele, auf denen Kapverdianer mit gezückter Hacke lustlos hämmern."
Eine Wasserspülung ist kaputt und gerät zum Memento mori: sie lässt "die Streben der Fenster wie Knochen rappeln". Es ist die Rede von der "schlaffen Ruhe Lissabons", den "sanften Farben des Abends", dem "trägen, kranken Verkehr". Alles in einem Satz. Sogar die Busse seufzen im Lissabon des António Lobo Antunes. Es ist Endzeit, aber die Erinnerung hört nicht auf: Erschöpft vom Dasein treffen sich vier Soldaten der letzten portugiesischen Kolonialkriege. "Lissabon hat sie alle verschluckt, Herr Hauptmann, jeder ist in seine eigene Richtung gegangen wie ein Wurf, der sich verstreut, sagte der Leutnant. Und heute, nach zehn Jahren wieder hier vereint, sind wir nicht mehr dieselben: es ist so viel in dieser Zeit passiert."
Der Rest sind die Details misslungener Leben. Vier Leute sprechen wild durcheinander, ihre Geschichten, ihre Leben durchkreuzen sich, sie reden, und einer hört zu. Antunes' Romane sind polyphone Klanggebilde, zerfetzte Rede, jede Stimme ein Instrument im vom Autor dirigierten Orchester. "Jede Kunst bewegt sich auf Musik zu, und die Musik auf die Stille. Von Buch zu Buch möchte ich mehr Stille in ihnen haben. Damit der Leser den Raum bekommt, sein eigenes Buch zu schreiben."
"In der ersten Version von ‚Fado Alexandrino'", erinnert sich Antunes an den Schreibprozess, "waren es vier Leute, die direkt zu einem Fünften sprachen. In der letzten Fassung war der Fünfte einer, der da war, aber kaum mehr existierte." Das weiß Antunes noch, doch mehr nicht, sagt er. Das Buch ist zwanzig Jahre alt (seltsam durcheinander erscheinen Antunes' Romane in Deutschland), aber dann war er anlässlich der deutschen Lesung doch überrascht von der Qualität der Prosa.
"Als das Buch fertig war, war ich im Urlaub mit meinen Töchtern. Sie waren noch sehr klein. Ich glaube, die Jüngste war noch nicht einmal geboren. Das Buch war fertig, und ich schmiss es weg und fing von neuem an. Das Manuskript ekelte mich an. Ich habe sehr spät verstanden, dass in der ersten Version das ganze Buch steckt. Man muss es nur neu schreiben." Antunes sammelt sich, seltsam pendelt seine Rede zwischen Selbsterklärung und Ratschlag. "Manchmal", fährt er dann fort, "habe ich die Vorstellung, dass ein Roman wie eine alte Statue ist, die im Garten begraben liegt. Man muss sie frei scharren, die welken Blätter, die Erde, die toten Insekten."
Nicht umsonst erntet Antunes mit seinen Büchern entweder helle Begeisterung oder ein hilfloses Schulterzucken. Wer Antunes liest, ist Fan; wer kein Fan ist, liest ihn nicht. Mit dem Bleistift hinter dem Ohr kommt man Antunes' Texten kaum bei, die Bastler unter den Kritikern runzeln die Stirn, und wer Gewissheit sucht in der Lektüre, wird von Antunes gewiss im Stich gelassen. Wer spricht? Was geschieht? Wo sind wir? Und wann? - das alles sind Fragen, die zweitrangig sind im Erzähluniversum des Portugiesen, und vielleicht "liest" man ihn besser gar nicht, sondern geht einfach mit, taucht ein in den Strom der Rede, lässt sich treiben und an ein Ufer spülen zum Schluss, erschöpft und nass und mit sausenden Ohren. "Ich möchte nicht gelesen werden", sagt Antunes. "Ich möchte, dass mein Buch eine Art Krankheit ist. Als litte man an einem Fieber."
Der pathologischen Lektüre entspricht ein pathologisches Schreiben. António Lobo Antunes ist ein zwanghafter Autor. Zwar gehören die 18 Stunden, die er angeblich schreibt am Tag, ins Reich der Legende, auf acht oder zwölf aber bringt er es, und es geht leichter, sagt er, wenn er müde wird. Dann ist der innere Zensor erschöpft, der Ratio tun die kalten Augen weh, und die schiere Angst ist eingeschlafen und träumt unruhig. Panikzustände, habe er, bevor er ein Buch beginne, gesteht Antunes, und auch vor dem Neuanfang am nächsten Morgen fürchte er sich. "Hör' in der Mitte eines Satzes auf", sagt er wieder im Ton des Älteren, der auch nicht mehr weiß, das aber schon länger. "Morgens ist es einfacher, wenn ein halber Satz schon da steht. Schreib' nie ein Kapitel fertig am Abend."
Der Nobelpreiskandidat Antunes entstammt geordneten Verhältnissen. Sein Vater war der Chefarzt des Hospitals Miguel Bombarda mitten in Lissabon, einer psychiatrischen Klinik, und sein Sohn ist ihm auf dieser Stelle nachgefolgt, bis ihn, wie er sagt, die Doppelbelastung fast umbrachte. Danach schrieb er nur noch.
Davor kam der Krieg, die Nelkenrevolution, in deren inneren Zirkeln sich Antunes bewegte, deren so entschlossene wie seltsam konzeptlose Protagonisten er kannte und teilweise bewunderte, keinen aber so wie Ernesto Melo Antunes. "Mein Hauptmann", nennt er ihn in der Widmung zum "Handbuch der Inquisitoren". Jetzt ist er tot, Antunes vergisst nicht, das zu erwähnen. "Damals kam er mir vor wie ein alter Mann."
Von seiner Kindheit erzählt Antunes in dürren Worten. Was zählt, ist die Initiation eines Schriftstellers: "Mit vier bekam ich Tuberkulose und meine Mutter brachte mir das Lesen bei. Ich war allein und las. Dann fing ich an zu schreiben: Gedichte, Geschichten, alles. Es war eine faszinierende Entdeckung: Man setze Wörter zusammen und es ergab einen Sinn. Es wurde eine Sucht."
Mit 19 begann Antunes seinen ersten Roman, ein endloses Projekt, das über zehn Jahre auf vier- oder fünftausend Seiten anschwoll. Antunes schrieb daran das Studium hindurch, er nahm das Manuskript mit in den portugiesischen Kolonialkrieg nach Angola, den er 27 Monate lang überlebte. "Ich schrieb sogar in den Bombenkratern", erzählt er, das habe ihm den Verstand gerettet. Eine seiner Töchter müsste heute das gewaltige, nie veröffentlichte Manuskript haben, sagt er, scheinbar vermutend. Tatsächlich wird er es wissen. "Alle Bücher, die ich später geschrieben habe, stammen von diesem Buch ab. Sie sind entwickelte Passagen dieses einen enormen Romans."
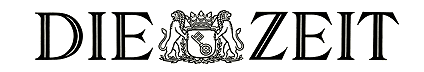
MÄRZ 2002
ROMAN
Fado Alexandrino
Von Martin Lüdke
António Lobo Antunes : Fado Alexandrino Aus dem Portugiesischen von Maralda Meyer-Minnemann; Luchterhand Literaturverlag, München 2002; 795 S., 29,50
António Lobo Antunes : Geh nicht so schnell in diese dunkle Nacht ; Luchterhand Literaturverlag, München 2001; 590 S., 25
Hut ab! Das ist Weltliteratur. Eine portugiesische comédie humaine, mit den Mitteln des späten 20. Jahrhunderts erzählt, kompromisslos, mit Rücksicht nur auf das, was erzählt werden muss. Aber rücksichtslos gegen den Leser.
António Lobo Antunes bietet keine eingängigen Geschichten, sondern Geschichte, die in seinen Figuren lebendig wird. Seine Romane sind angeschlossen an den großen Strom der Rede, der die Menschen miteinander, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Gegenwart und vielleicht auch mit ihrer Zukunft verbindet. Lobo Antunes betreibt eine Archäologie der Erinnerung. Seine Figuren sind bevorzugt Opfer, aber nie Pappkameraden. Es sind kantige Gestalten, die ihre eigenen Ansichten verkünden, persönliche Einsichten vermitteln, Empfindungen, auch Ressentiments und Vorurteile, aber nie die Meinung des Autors. Sie sind hochgradig individualisiert, sogar dann, wenn sie nichts Besonderes verkörpern, Dienstmädchen, Soldaten, Buchhalter. Oder, zum Beispiel, Maria Clara.
Das Mädchen steigt heimlich auf den Dachboden, um herumzukramen und, mehr als nur neugierig, hinter die Geheimnisse ihrer Familie zu kommen, die dunkle (Vor-)Geschichte ihres Vaters aufzudecken. So setzt ein innerer Monolog ein, der sich zuweilen vielstimmig auffächert, weit ausgreift und doch immer wieder auf das Mädchen zurückkommt, auf das schwierige, eigentlich nur in seiner Vorstellung existierende Verhältnis zum Vater. In zwei Sätzen entfaltet Lobo Antunes die Ausgangsposition seines jüngsten Romans: „Mein Vater hat mir nie erlaubt, hier einzutreten. Er wird sich auf den Schaukelstuhl gesetzt und aus der Dachluke hinunter in den Garten, auf das Tor, auf die Straße, auf mich als kleines Mädchen geschaut haben, wie ich am Ufer des Teiches mit meiner Schwester spielte, wir seien Feen.“
Das Verbot gilt nach wie vor. Nur ist der Vater, der nach einem Herzinfarkt todkrank in der Klinik liegt, nicht mehr in der Lage, es durchzusetzen. Der zweite Satz überschreitet bereits den Raum sicherer Gewissheit, stellt Mutmaßungen an. Das spärliche Wissen der Tochter wird von ihrer Fantasie aufgefüllt. Der Vater „wird“ da gesessen, sogar „auf mich“ geschaut haben. Die Mädchen, dazu bedarf es der Fantasie, hatten „Feen“ gespielt. Jetzt träumt sich Maria Clara in diese Zeit zurück, lässt ihre Wünsche Wirklichkeit werden und erinnert doch ganz genau die grausame Realität. In Wahrheit hat sich der Vater nie um seine Kinder geschert. Selbst der Blick bleibt Wunschvorstellung. Eigentlich hat ihr der Vater niemals Aufmerksamkeit, „allenfalls stummes Missfallen“ zukommen lassen.
Aus dieser Konstellation entwickelt António Lobo Antunes die Fortschreibung seiner großen Chronik des portugiesischen Bewusstseins, also einen Roman von immerhin 600 Seiten. Geh nicht so schnell in diese dunkle Nacht. Der Titel variiert einen Vers von Dylan Thomas. Das Buch ist nicht nur die kunstvollste, sondern auch die radikalste Fassung seines polyfonen Erzählens. Maria Clara, die Protagonistin, spricht nicht nur, wie bei ihm üblich (was nie einfach zu lesen war) den dominanten Part, sondern sie allein imaginiert auch alle anderen Stimmen. In ihrem Kopf spielt der gesamte Roman. Das vielstimmige Durcheinander erscheint damit als Produkt ihrer Einbildungskraft, wird aber zugleich mit einem Eigenleben ausgestattet, das sich der Logik der Szenarien verdankt, die das Mädchen, probeweise, zur Rekonstruktion und Erklärung ihrer Familiengeschichte entwickelt. Maria Clara stellt sich zum Beispiel vor: Adelaide, das Dienstmädchen der Großmutter, könnte die Mutter des Vaters sein, ein verheirateter Lehrer aus der Gegend – sein Vater. Solche Möglichkeiten werden zur erzählten Wirklichkeit. In großen, spiralförmigen Bewegungen führen diese Vorstellungen aber immer wieder zu dem Mädchen zurück, das sich nach der Liebe des Vaters sehnt. Sie hat lange darauf sparen müssen, um ihrem Vater einen goldenen Füllfederhalter zu schenken. Damit, hoffte sie, kann sie ihm ihre Liebe bezeugen und zugleich seine Dankbarkeit herausfordern. Innerlich zitternd, übergibt sie ihr Geschenk. Der Vater bringt gerade noch ein gefühlloses „Dankeschön“ über die Lippen und legt den wertvollen Füller beiseite, zu den billigen Kugelschreibern, die sich bei ihm angesammelt haben.
Als Militärarzt in Angola
Sehnsucht und Schmerz, daraus entspringt die Energie der ausgreifenden Rekonstruktions- und Erklärungsversuche von Maria Clara. Dabei liegt Lobo Antunes jeder psychologische Realismus so fern wie die Konzession an ein reibungsloses Unterhaltungsbedürfnis seiner Leser. Die jeweiligen Figuren bringen ihre jeweilige Geschichte mit. Das verbindet sie mit der portugiesischen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Die unglücklichen Familiengeschichten spiegeln zugleich das portugiesische Drama und Trauma.
Dafür steht Lobo Antunes auch mit seiner eigenen Biografie ein. 1942 wurde er als Sohn des Chefarztes einer großen Lissaboner Klinik geboren. Er wuchs in dem vornehmen Stadtteil Benfica auf, ist selbst Arzt geworden, hat als Chirurg bei der Armee im Kolonialkrieg in Angola gedient – „27 Monate im Kampfgebiet“, lautet lapidar eine Eintragung in seinem Lebenslauf. Danach hat er seine medizinische Ausbildung fortgesetzt, ist Facharzt für Psychiatrie geworden und hat lange Jahre als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Jetzt schreibt er nur noch, bis zu 18 Stunden am Tag. Er muss offenbar erzählen, Schuld abtragen, (s)ein Trauma verarbeiten. Die kompromisslose Radikalität seiner Bücher verbietet allerdings die Spekulation über seine persönlichen Beweggründe. Der einstige Arzt stellt sich einer Aufgabe.
Die portugiesische Revolution von 1974, eher ein Militärputsch, fegte in einer einzigen Nacht 50 Jahre Salazar hinweg. Die gemäßigt-faschistische Diktatur war überfällig. Doch wirklich geändert hat sich wenig. Der politische Terror wurde durch den ökonomischen ersetzt. 500 Jahre lang hatte Portugal Teile Afrikas und Asiens beherrscht. 1975 sind die letzten Truppen aus den Kolonien Angola, Mosambik und Guinea-Bissau zurückgezogen worden. Das einstige Weltreich Portugal war zusammengeschrumpft auf einen armen, rückständigen kleinen Staat am Rand Europas. Überfordert mit den Problemen, die durch den Rückzug auf das Land zukamen. Denn mit den Truppen kamen auch die Siedler zurück, die Beamten, die Missionare und mit ihnen all die gestrandeten Existenzen, abgerissene, oft zwielichtige Gestalten, gebrochene Menschen.
In dem Roman Fado Alexandrino, der jetzt erst, 20 Jahre nach seinem Erscheinen, ins Deutsche übersetzt worden ist, treffen sich fünf Veteranen des Kolonialkriegs, zufällig zusammengewürfelt, unterschiedlichen Ranges, arme Schweine allesamt, fast zehn Jahre nach der portugiesischen Nelkenrevolution in einer Kneipe. Essen, saufen, reden und ziehen schließlich alle gemeinsam noch in ein Nachtlokal. Vier von ihnen sprechen, einer, der Hauptmann, hört nur zu.
Der Roman besteht ausschließlich aus den Gesprächen, die diese Männer führen, nicht immer miteinander, oft stehen auch Selbstgespräche dazwischen, innere Monologe. Es geht um kaputte Ehen, zerstörte Beziehungen, um das berufliche Fiasko der Heimkehrer und, wenn auch nur am Rande, um die politischen Verhältnisse und ihre Veränderung. Viele komische, kuriose Episoden werden erzählt, die Lebensläufe der Protagonisten überkreuzen sich mehrfach. Einer ist der Liebhaber der Frau eines anderen. Der andere hält sich eine Mätresse und wird von deren Familie ausgenommen wie die sprichwörtliche Weihnachtsgans.
Die einzelnen Sprecher, oft nicht einmal gekennzeichnet, sind anfangs kaum auseinander zu halten. Sie sprechen einen Abschnitt, dann kommt der nächste Sprecher, der meist gar keinen Bezug zu seinem Vorredner herstellt. Am Ende – sie reden alle durcheinander – wechselt seitenlang der Sprecher satzweise. So hat Lobo Antunes immer gearbeitet.
Ich habe mit diesen beiden Romanen fast 1500 Seiten nahezu in einem Stück gelesen. Wenn man nicht „dran“ bleibt, muss man immer wieder von vorn anfangen, um überhaupt etwas zu verstehen. Also wahrlich kein reines Vergnügen, fast eine Tortur. Aber alles andere als ein Akt des Masochismus. Denn eine große Befriedigung stellt sich ein. Weil das Ergebnis der Anstrengung sichtbar wird. Noch immer leicht verschwommen, so undeutlich klar wie Gerhard Richters Bilder-Zyklus aus dem deutschen Herbst.
Roman und Tortur
António Lobo Antunes hat sich einmal dafür entschuldigt, dass er „nicht undeutlicher geworden“ sei. Diese Unschärfe ist also nicht nur gewollt, sondern das präzise Resultat seines umständlichen Verfahrens. Nicht nur Menschen und Schicksale gehen auf diese Weise in die Erinnerung des Lesers ein, sondern weit mehr. Bekanntlich wirkt in alle private Erinnerung der „sinngebende und strukturierende Einfluss unseres gesellschaftlichen Lebens mit seinen Normen und Werten“, auch seinen Gewichtungen, unmittelbar ein. Deshalb, so der Wissenschaftler Jan Assmann, sei es unmöglich, zwischen dem individuellen und dem sozialen Gedächtnis strikt zu unterscheiden. Assmann schlägt darum den Begriff des „kommunikativen Gedächtnisses“ vor. „Dieses Gedächtnis gehört in den Zwischenbereich zwischen Individuen, es bildet sich im Verkehr der Menschen untereinander heraus. Dabei spielen die Affekte die entscheidende Rolle.“
Also Liebe, Interesse, Anteilnahme, auch Hass, Feindschaft, Misstrauen, Schmerz, Schuld und Scham. Diese Empfindungen „geben unseren Erinnerungen Prägnanz und Horizont“. Aus dem Horizont beziehen sie ihre Bedeutung. Die Prägnanz sichert ihnen Einprägsamkeit. Ein solches Gedächtnis ist nicht fotografisch. Horizont und Perspektive dieser Erinnerungsräume sind affektiv vermittelt.
Diese Beschreibung entspricht nun exakt dem impliziten Programm des großen portugiesischen Erzählers António Lobo Antunes. Seine Bücher schließen an das kommunikative Gedächtnis der portugiesischen Gesellschaft an. Die Gespräche des Oberstleutnants mit seinen alten Kameraden, die Gespräche von Maria Clara mit ihrem Vater, der unendliche Redefluss, der sich durch die Romane von Lobo Antunes zieht – immer bewegen wir uns in dem Zwischenraum zwischen individuellem und sozialem Gedächtnis. Vermutlich ist die Literatur das privilegierte Medium ihrer Darstellung. Das heißt: das Abbild einer Wirklichkeit, die alles über die Realität sagt, die es aber so – das heißt in dieser sinnlichen Prägnanz – nur in der Literatur gibt.
N Z Z Online
Neue Zürcher Zeitung, 20. Januar 2005, Ressort Feuilleton
Afrika als Seelendrama
Antonio Lobo Antunes' erster Roman liegt endlich auf Deutsch vor
Kersten Knipp
Antonio Lobo Antunes: Elefantengedächtnis. Roman. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand, München 2004. 207 S., Fr. 31.90.
Irgendwo zwischen Veranlagung und Geschichte muss das seinen Ursprung haben, was mangels besseren Namens «Schicksal» oder «Verhängnis» heisst. Nur, wie sind die Anteile gewichtet? Sicher, der Protagonist von Antonio Lobo Antunes' erstem, nun ins Deutsche übersetztem Roman, «Elefantengedächtnis» , gehört zur «Sorte der hoffnungslos Sanften». Das ist ihm selber zwar klar, macht allein aber noch kein Unglück aus. Wann also hat es ihn dann getroffen, «wann hat die Scheisse angefangen?», wie er sich unaufhörlich fragt. Psychiater zu sein, das hilft dem Protagonisten nicht viel, nicht mehr jedenfalls als allen anderen auch, die seit den 1960er Jahren nach Angola geschickt wurden, um dort die Einheit des kolonialen Reiches zu verteidigen. «Angola», das ist die Chiffre einer verlorenen Generation, die über Verletzung, Verstümmelung und Verwesung die Lust am Leben verloren hat und diese auch in Friedenszeiten nicht mehr findet. In den killing fields des südwestlichen Afrika wurde ihr die Seele zerballert. Und wieder zusammenflicken lässt sich das filigrane Organ nicht.
Schleier über der Welt
Allerdings: Was Angola der Seele des Arztes an Schaden zugefügt hat, das erstattet sie dem Roman an literarischer Grösse. Der hoffnungslos sanfte Protagonist, dessen Wegen und Irrwegen der Leser 24 Stunden lang folgt, wäre auch ein hoffnungslos uninteressanter, langweiliger Fall, hätte er nicht jenes afrikanische Labyrinth durchschritten, dem er, jedenfalls physisch, einige Jahre zuvor entkommen ist. «Wann hat die Scheisse angefangen?», dies die grundsätzliche Frage dieses Romans. Sie würde ihn, hätte es nicht Angola gegeben, in einen einzigen sentimentalen Fado verwandeln. Durchgehend trüb präsentiert sich die Atmosphäre Lissabons in den Jahren nach der Nelkenrevolution, durchgehend unversöhnlich die Laune des Helden. Ein Schleier liegt über seiner Welt, aufgemischt allein durch seine Abscheu gegen jene «Hunderte von kleinen Salazars», die dem Diktator nach seinem Ableben noch aus dem Bauch gekrochen sind und jetzt die Atmosphäre des Landes vergiften. Vergiften sie sie wirklich? Oder verbreiten sie, nach der Revolution in neue Ämter und Würden gelangt, nur jenen Mief, der Wendehälsen nach Epochenbrüchen entströmt?
Zwischen Gift und Gestank besteht ein Unterschied, nur fragt sich, ob er objektiv oder subjektiv zu bestimmen ist. Lobo Antunes' Arzt, hinter dem man mit einigem Recht den Autor selbst vermuten kann, hat sich für die Strategie der subjektiven Begründung entschieden. Doch die Art, in der er sie formuliert, zeigt, aus dem Abstand von mittlerweile 25 Jahren, dass auch Subjektivität dem Zeitgeist stärker verbunden ist, als es im Moment ihrer Äusserung den Anschein hat. Was etwa ist sein eigenes Fach, die Psychiatrie, die eigentlich den Menschen doch helfen soll? Für den Arzt vor allem dieses: ein Instrument nicht der Hilfe - das versteht sich für den desillusionierten Mediziner von selbst. Sie ist aber auch keines der Kontrolle. Die Psychiatrie ist die Rache der Angepassten an jenen, die sich den Verhältnissen nicht anpassen. Deshalb muss der Arzt von seiner Disziplin sprechen «als grober Entfremdung, als Rache der Kastrierten gegen den Penis, den sie nicht haben, als realer Waffe der Bourgeoisie, der ich qua Geburt angehöre und der so schwer abzuschwören ist, weshalb ich zögere, wie ich zwischen der bequemen Unbeweglichkeit und der schmerzlichen Revolte zögere, deren Preis hoch ist, denn wenn ich keine Eltern hätte, wer in der Runde würde mich dann an Kindes Statt nehmen?».
Raffiniert und widerständig
Sprachfetzen der «politischen Psychiatrie» ebenso wie die Vorstellung vom Wahnsinnigen als seelisch befreitem Menschen schwingen in diesen Sätzen mit, beides Schöpfungen jener siebziger Jahre, von denen Lobo Antunes handelt und in denen er diesen Roman auch schrieb. Ganz so entschieden mag man das heute nicht mehr sehen. Wenn man den Roman dennoch als Kunstwerk bezeichnen will, dann darum, weil er solche Topoi und Stereotype grösstenteils eben doch vermeidet. Der Protagonist ist ein leidender, aber höchst eigenwilliger Mensch, mit einer ebenso raffinierten wie widerständigen Sprachfähigkeit versehen, die, das allerdings, seine Egozentrik nicht einzugrenzen vermag: «Da er keine Grosszügigkeit, Toleranz und Sanftheit besass, war er nur darum besorgt, dass man sich um ihn kümmerte, und hatte sich selbst zum einzigen Thema einer monotonen Symphonie gemacht.» Hier scheint sie auf, jene Kritik des Erzählers an seinem Protagonisten, eine Kritik, die alles Selbstmitleid verscheucht, ohne aber die Welt am Ende doch heller zu machen.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Ockerfarben für einen wütenden Psychiater
Dem Debütroman "Elefantengedächtnis" des meisterhaften António Lobo Antunes fehlt der monologische Überschuss
VON FRIEDHELM RATHJEN
António Lobo Antunes: "Elefantengedächtnis." Roman. Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Literaturverlag, München 2004, 207 Seiten, 18 Euro.
Die Geschichte ist simpel. Wir erleben einen Tag im verkorksten Leben eines Psychiaters. Morgens geht er im Krankenhaus lustlos seiner Arbeit nach, unterdrückt mit Mühe "die zerstörerischen Triebe seiner Seebebenwutanfälle" und fragt sich: "Wann hat die Scheiße angefangen?" Er hält es an diesem Tag noch weniger aus als an den meisten, ruft schließlich einen Freund an und verabredet sich mit ihm zu einem Mittagessen, bei dem er keinen Bissen herunterkriegt. Er meint, er sei "ganz unten angekommen", verspürt nichts als eine große Leere, die ihm auch sein Freund nicht austreiben kann.
Die Leere rührt maßgeblich daher, dass der Psychiater (seinen Namen erfahren wir nicht, er heißt immer anonym "der Arzt") aus einem Grund, den er selbst nicht kennt, seine Frau verlassen und dadurch "Bodenhaftung und Richtung verloren" hat. Er trauert zumal seinen Kindern nach, die er nachmittags heimlich beobachtet, wie sie aus der Schule kommen. Außerdem hat er einen Termin beim Zahnarzt und einen anderen bei einem Therapeuten.
Unser unheldischer Held nimmt beide Termine wahr, wenn auch nicht sonderlich pünktlich, fährt mit seinem klapperigen Auto durch Lissabon, denkt an eine überfahrene Möwe, die er in der Vorwoche gesehen hat, und bildet sich ein: "Diese Möwe bin ich, und der vor dem Ich flieht, bin ich auch." Mit den Säufern einer Bar kann und will er nichts anfangen, er steht im Begriff, "in die kleine möbellose Wohnung zurückzukehren, in der ihn niemand erwartete", folgt dann doch noch einem Augenblicksimpuls und fährt ins Kasino, wo er glücklos im Spiel bleibt und glücklos mutmaßlich auch in der Liebe. Die Frau, die er dort aufreißt - oder besser: sie ihn -, ist alt, "verbraucht" und vulgär. Am Ende des Tages und des Romans schläft sie in seinem Zimmer; er aber ist wach und beginnt zu monologisieren: "Es ist fünf Uhr morgens, und ich schwöre dir, dass du mir nicht fehlst."
Wütend, aber nicht plump
Als Elefantengedächtnis, der erste Roman, den António Lobo Antunes veröffentlichte, 1979 in Portugal erschien, war das eine Sensation. Hier kotzte sich einer aus, in wüsten und wütenden, freilich stilistisch alles andere als plumpen Worten, hier zog einer über seine eigene Herkunft und die portugiesische Gesellschaft und, so schien es, über Portugal insgesamt auf eine Weise her wie niemand zuvor. Der Held ist zwar ein egoistischer, penetrant tatenloser und selbstmitleidiger Feigling, aber er hat keine Mühe, die Verantwortung für seine Defekte "dem System" in die Schuhe zu schieben.
Dass er ausgerechnet in einem Irrenhaus arbeitet, ist eine Großmetapher jener Welt, an der er leidet. Das Leben findet er "obsolet und zerbrechlich (. . .) wie Nippes", sich selbst hält er für den "größten Höhlenforscher der Depression", und er spürt, er hat "aus seinem Leben eine Zwangsjacke gemacht".
"In einem Irrenhaus, wo sind da die Irren?" Unser Arzt scheint zu glauben, jeder sei für das verantwortlich, woran er arbeitet, der Irrenarzt also für den Irrsinn und die Sozialarbeiterinnen, "die selbst dringend Hilfe benötigten", für das allgemeine Elend. Was dieses Spiegelprinzip für den Psychiater und Dauerleider selbst bedeutet, ist unschwer auszumachen. Er suhlt sich geradezu in der "haltlosen Angst vollkommener Einsamkeit" und rührt in seinem Schädel einen wüsten Sprachwirbel ziel- und richtungsloser Metaphern an: "auf der Bühne der Gehirnwindungen folgten schwindelerregende, wirre Bilder aufeinander", und die versucht er in Sprache umzusetzen, denn unser Psychiaterheld ist ein heimlicher Dichter, für den "das Herumhantieren mit Worten eine Art heimliche Schande" ist, "eine ewig aufgeschobene Obsession". Gegen die Welt, mit der er nicht zurechtkommt, setzt er sich zur Wehr, mit Versen von Dylan Thomas oder Liedern von Paul Simon im Kopf. Er wünscht sich, "in die Bilder Cimabues zu springen und sich in den verblichenen Ockertönen (...) aufzulösen".
Realität, die sich in überbordenden Bilderstrudeln auflöst, so könnte man den typischen Lobo-Antunes-Stil beschreiben. Dieser in seinen späteren Romanen perfektionierte Stil ist in dem nun wieder aufgelegten Erstling durchaus schon vorhanden: Die Sätze sind lang und ausladend, viele zerdehnen sich durch Partizipialkonstruktionen und schaffen eine Art Gleichzeitigkeitsprosa, wie sie außer António Lobo Antunes niemand schreibt. In Elefantengedächtnis schlägt die sprachliche Wucht freilich noch weitgehend ins Leere, und zwar nicht nur in jene innere Leere des Helden, der an einer "ewigen Schwierigkeit" leidet, "Worte hervorzubringen, die trocken und genau sind wie Steine".
Eine Art Leerlauf entsteht durch das Erzählen in der dritten Person. Da eigentlich nichts zu erzählen ist außer dem, was der Held erlebt und empfindet und denkt, ist der Erzähler überflüssig und wirkt wie eine Zwangsjacke. Mehrmals begehrt das Ich des Helden gegen diese Zwangsjacke auf, mehrmals drängt er plötzlich als "ich" in den Erzählraum vor, was stets durch ein "sagte sich der Arzt" oder "dachte der Psychiater" kaschiert wird. Einmal scheint die Befreiung greifbar nahe, scheint das Er zum Ich zu werden: "Scheiße Scheiße Scheiße Scheiße Scheiße, sagte er in seinem Inneren, weil ich in mir keine anderen Worte als diese fand, eine Art schwacher Protest gegen die kompakte Traurigkeit, die mich erfüllte." Erst ganz zum Schluss lässt Lobo Antunes das Ich endlich frei, und der einsame Held darf monologisieren, wobei er die abwesende Frau anredet, die er liebt und verlassen hat: "Ehrenwort, ich denke nicht an dich. (. . .) Du magst das idiotisch finden, aber ich brauche etwas, das mir hilft zu existieren."
Was die Prosa von António Lobo Antunes braucht, um zu existieren, ist genau diese ungehemmte Monologsituation. Erst auf den letzten zwei Seiten von Elefantengedächtnis schafft er den Sprung in sein eigentliches Werk, alles vorherige ist ein fauler Kompromiss, der Versuch, auf eine Art zu schreiben, die (noch) nicht die seine ist. Sein zweiter, beinahe gleichzeitig entstandener und wenige Monate nach Elefantengedächtnis veröffentlichter Roman Der Judaskuss ist folgerichtig ein einziger ungefilterter innerer Monolog und damit der eigentliche Fanfarenstoß dieses unvergleichlichen Autors. Elefantengedächtnis ist der Anlauf, den Lobo Antunes nimmt, um in seine eigene Romanwelt zu springen, und da wir diese Welt schon kennen, ist es höchst aufschlussreich, diesen Anlauf zu studieren. Als Roman eigenen Rechts aber ist Elefantengedächtnis gescheitert.
Nächste Seite, hier