
14-11-2009
Der Turm, by Uwe Tellkamp

December 31, 2008
Uwe Tellkamp
DER TURM
Geschichte aus einem versunkenen Land
976pp. Frankfurt: Suhrkamp. ¤25.50.
978 3 51842 020 1
Marcel Beyer
KALTENBURG
394pp. Frankfurt: Suhrkamp.¤19.80.
978 3 51841 920 5
Ingo Schulze
ADAM UND EVELYN
320pp. Berlin Verlag. ¤18.
978 3 82700 810 7
Lukas Bärfuss
HUNDERT TAGE
Göttingen: Wallstein.
¤20.50.
978 3 83530 271 6
It is December 1982 in Dresden, and the lights of a defective string of plastic lemons flicker on a public Christmas tree. Uwe Tellkamp begins Der Turm (The Tower) with a classic image of Eastern Bloc shoddiness, but the novel soon swoops up towards a far less familiar GDR – a genteel hillside district of Jugendstil mansions and wrought-iron balconies high above Dresden, home to a group of people who were not supposed to exist in this people’s republic: the bourgeois intelligentsia. Tellkamp’s book, which won the 2008 German Book Prize and set critics swooning, addresses a question that has greatly preoccupied German culture of late: What was the GDR? This year, German-language fiction provided some provocative answers, and none were more resonant than those offered in Tellkamp’s 976-page work.
Born in 1968, Tellkamp grew up in the Dresden milieu his characters inhabit. A practising doctor until 2004, he was briefly imprisoned and banned from studying medicine after refusing, during his East German military service, to help suppress a demonstration in October 1989. Der Turm’s Christian Hoffmann, who must volunteer for the army in order to be allowed to pursue his medical studies, bears elements of the author’s life. He chafes against his military service, lands in a dismal military prison and finds himself condemned to a further two-year spell in the army. Christian’s father Richard, a prominent surgeon, navigates a system steeped in corruption, where his extramarital dalliances have left him especially vulnerable to Stasi blackmail. Richard’s brother-in-law Meno Rohde, a zoologist barred from his profession because of his ties with the church, works as an editor at a publishing house where he must carry out the day-to-day tasks of the East German censorship apparatus. As the three protagonists move through 1980s Dresden and are joined by an ever-swelling cast of characters, Tellkamp opens up a kaleidoscopic view on to a world of endless queues, bureaucratic mazes, bribery, pervasive shabbiness and general decline, which his characters try to counter by retreating into the past. Following the characters’ experiences, the narration is sometimes matter-of-fact, sometimes caustic and sometimes desperately angry. This is a society out of proportion, in which necessary things are in short supply and useless ones available in excess. Poison trickles through the book: industrial pollution gives rise to strange microclimates on the islands in the Elbe, where tropical butterflies flourish; the characters’ insular nostalgia becomes an illness, “the sweet malady called yesterday”. Der Turm is a novel that overflows and overpowers: it is rendered in sentences as baroque as the old Dresden Tellkamp’s characters long for. Memories and impressions grow wild across the lattice of the plot, bringing the symphonic book to – but never over – the brink of cacophony. Tellkamp has said the tower of the title refers to the geography of the neighbourhood inhabited by his characters, to the ivory tower of their hermetically sealed subculture, as well as to the GDR itself, a latter-day Tower of Babel. Both the characters and the GDR live in denial of the passage of time, but in the background the clocks tick down to November 9, 1989. On the day the Wall falls, the book grinds to a halt, ending not in a full stop but a colon.
Marcel Beyer’s finely wrought Kaltenburg, another novel dealing with the question of what the GDR was, is set in striking proximity to Tellkamp’s tower. Beyer’s main character, the Austrian ornithologist Ludwig Kaltenburg, rules over an animal research institute in the same Dresden district – and amid the same GDR-denying intellectual salon culture. Strolling through this neighbourhood decades later, Kaltenburg’s onetime protégé Hermann Funk recounts for a young translator his life with the enigmatic Kaltenburg. Funk is fictional; Kaltenburg, less so. He is based on the Nobel Prize-winning Austrian zoologist Konrad Lorenz. Among the characteristics Kaltenburg shares with Lorenz are his knowledge of jackdaws and his murky Nazi-era past. Funk is a young boy in wartime Posen, when he first meets Professor Kaltenburg, an academic colleague of his father’s. At the end of the war, Funk flees with his family to Dresden, where Kaltenburg – barred from a professorship in Austria because of his membership of the Nazi party – soon also takes up residence. The institute Kaltenburg founds in Dresden is, in its 1950s heyday, a raucous menagerie: fish in the basement, ducks and dogs wandering the main floors, hamsters nesting in the cabinets, a cockatoo squawking through the house, Kaltenburg’s prized flock of jackdaws in the attic. Beyer is at his best when describing animals: they anchor the book’s most memorable scenes. Kaltenburg’s birds circle over many of the grimmest moments of twentieth-century German history, and the human–animal relationship finds an unexpected portal into this history. In one haunting and beautifully rendered scene, a group of apes wanders the rubble of Dresden the morning after Funk loses his parents in the Allied firebombing of February 1945. Seeing the human corpses strewn on the street, these escaped zoo animals join the human survivors in piling up the dead. “Leben heißt Beobachten” is Ludwig Kaltenburg’s motto:observation is life. Kaltenburg, a book as fine-boned as the birds that flock its pages, is a meditation not only on the observation of nature but also on the nature of observation, and the varieties and limits of memory. Gaps in our knowledge of the past go unfilled: we assume Funk’s parents died in the bombing, but are never certain; the extent of Kaltenburg’s war guilt also remains unclear. Funk’s wife Klara changes the subject to Proust whenever the post-war past is discussed, and Funk laments the inadequacy of his memory: “It could be that my memory seamlessly joins together a row of scenes that are actually separated by months or even years, could be that even in remembering one is allowed no breathing time”.
Ludwig Kaltenburg dies in 1989, the eventful year in which Adam und Evelyn, Ingo Schulze’s new novel about the end of the GDR, is set. In late summer, as the Soviet satellite states groan with impending collapse, we meet the title characters of this prelapsarian romp. In an unnamed provincial East German town, Adam is enjoying his lot in life. A gifted dressmaker, he makes beauties of the otherwise ordinary local women who come to him cradling bolts of cloth obtained from the West. For this the women love him, and he beds as well as outfits his adoring clientele – a habit that sets the novel in motion when Evelyn, Adam’s girlfriend, walks in on him naked with Lilli. The indignant Evelyn takes off without him on their planned holiday to Lake Balaton; like a jovial stalker, Adam chases after her across Czechoslovakia and Hungary. Along the way, the pair fall into further entanglements with a lively East German hitchhiker Katja, a West German cell biologist Michael, who is working on a project to make human immortality possible, and a Hungarian family who offer them all hospitality. While characters couple and uncouple, the local border controls slacken and the campsites of Hungary flood with East Germans hoping to reach the West. Schulze’s novel is formally impressive. It consists almost entirely of snappy, naturalistic dialogues, portioned out in tasty little morsels in chapters of a few pages each: that the reader is able to deduce the plot events is in itself no small feat. Adam und Evelyn is a light, airy confection, and the Adam and Eve references that overlay this love story in the form of a road trip are more playful than systematic. In one of the book’s witty scenes, Adam and Evelyn find a Gideon bible in their first Western hotel room. Adam reads the Creation story aloud to Evelyn, who coaxes him to eat bits of – not fruit, but Leberkäse, a kind of Bavarian meatloaf. And, as in the Bible, it is the woman who comes off looking worst when this couple fall from paradise. The character of Evelyn never particularly charms. While the cigar-smoking Adam, trailing her in his vintage Wartburg with a pet turtle riding shotgun, is decorated with quirky character traits, she is young, pretty and little else. As long as she remains in the GDR, at least her grounds for going to the West seem admirable (she wants to pursue the academic studies she has been barred from in the East), but Evelyn turns out to have been lured not so much by forbidden knowledge as forbidden consumerism – spacious flats and expensive Swiss chocolates. Adam never wanted to cross over in the first place. His East Germany may or may not have been Eden – the book is far too coquettish to pin down the location of its lost paradise – but in any case he was content with his life there. His GDR was a place of ripe, succulent fruits, not of sad blinking plastic lemons. And paradise the West certainly is not. This is “original sin”, he says to Evelyn: “the drive always to want more and more money”.
While Schulze deftly flirts his way through paradise, another remarkable new novel performs a searing excavation of Hell. Like Tellkamp, Beyer and Schulze, the Swiss playwright Lukas Bärfuss has written a book that deals provocatively with history. But Bärfuss’s new novel Hundert Tage (2008) is set thousands of miles from Dresden, confronting not the GDR but the hundred days of the Rwandan genocide in 1994. Bärfuss has earned a reputation for taking his country to task for smug do-gooding and self-satisfied orderliness, and Hundert Tage, his first novel, proves no exception. As snow falls outside his home in the Jura mountains, the Swiss former aid worker David Hohl – the last name means hollow – tells an old school friend how he witnessed the massacres in Kigali. A young idealist who has dutifully read his Conrad and Césaire, David arrives in Rwanda in 1990 to work for the Swiss Agency for Development and Cooperation. He finds a life of postcolonial privilege and boredom, inhabited by expats who know little about Rwandans and cannot be bothered to learn the local language. Rwanda is seen as the African Switzerland: a tidy alpine landscape where quiet, hard-working farmers tend to longhorn cattle. Not yet ready for democracy, but a lovely target for aid money. David is uncomfortable with this condescension, but his criticism is uneven, impetuous. His morality comes in impulsive outbursts. Relief from boredom arrives with the outbreak of civil war. David watches with excitement as troops march through Kigali; Agathe, the cosmopolitan Rwandan woman he has been haplessly courting, finally succumbs to his advances. But she continues to puzzle David. Is the real Agathe a Europeanized student, a daughter of African farmers, locked in an eternal struggle with nature, or a militant Hutu inciting murder through a megaphone from the back of a flatbed truck? As the conflict escalates, David’s botched acts become a metaphor for the ineptitude of foreign intervention. Whether nursing an injured buzzard back to health against the locals’ protestations or inadvertently feeding ethnic tensions by giving his cleaning woman part of his garden to grow vegetables, the worst always comes of his attempts to set an upstanding example for the natives. In a final childish burst, wanting to prove to Agathe that he isn’t like the other white people and won’t run away at the first sign of trouble, he hides in his garden as the last foreigners are evacuated. The horrors of the ensuing hundred days are born of order, not chaos: “I know now that perfect order rules the perfect hell”, David says. Bärfuss takes the reader step by step down the path to genocide. He emphasizes the role of Western – and particularly Swiss – aid in supplying the modern tools of organization and communication that made atrocities on such a scale possible: “we gave them the pencil with which they wrote the death lists . . . we laid the telephone lines over which they gave the murder commands . . . we built the streets upon which the murderers drove to their victims”. David returns to Switzerland – home to “people who know what right and wrong are” – a “broken man”. When his tale of his experiences in Rwanda draws to its harrowing end, the broken man is left within a broken narrative frame. He is disabused of the illusions his countrymen hold, but can find nothing to replace them with. While Hundert Tage never directly addresses the Swiss role in the Holocaust, guilt beyond Rwanda is implicit: David remarks that the particular penchant of the Swiss is to swim in bloodbaths of others’ creation – and their particular good fortune to escape reprimand, as some greater wrongdoer is always present at the scene of their crimes to deflect attention. Hundert Tage is written in the spare, distilled language that befits its task, never sensational and never squeamish. A complex and exhaustively researched book, it never crosses into excessive didacticism. It is an unflinchingly political novel that brings across its devastating message without making any narrative compromises.
“Tale from a lost country” is the subtitle of Der Turm, and the making of histories and geographies of loss has long been a forte of German literature. Tellkamp, Beyer and Schulze have explored the GDR with commendable depth and complexity. Bärfuss’s book, meanwhile, has pointed to a promising new direction for German literature. The next literary generation will be well served if others of its best writers follow his lead in turning their considerable powers of observation outwards, towards losses less often chronicled by German-language writers.
Jane Yager is
a freelance writer and translator living in Berlin.
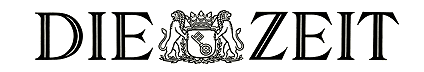
22-9-2008
Helmut Böttiger
Tellkamps klassischer Bildungsroman über die DDR erzählt meisterlich aus einer stillgelegten Zeit:
Dieses Buch steht außerhalb der Zeit. Es will sich nicht auf die herrschenden Bedingungen einlassen. Auf den ersten hundert, zweihundert Seiten glaubt man sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt, in ein behagliches, zurückgezogenes, deutsches bürgerliches Erzählen. Da werden Kindheitssehnsüchte und Naturbilder wachgerufen, wie man sie zuletzt wohl bei Adalbert Stifter oder Hermann Hesse gelesen hat – die stille Landschaft, die dunklen Bäume, die großen Wohnungen mit ihren Schatten spendenden Gärten und den fein ziselierten Intarsien der Möbel. Das soll das Buch sein, das vom Literaturbetrieb seit geraumer Zeit so heftig umraunt wird?
Uwe Tellkamp, 1968 in Dresden geboren und zur Zeit des Mauerfalls Panzerkommandant bei der Nationalen Volksarmee, hat 2004 den Klagenfurter Lesewettbewerb mit einem furiosen Ausschnitt aus diesem Roman gewonnen. Aber es war noch nicht abzusehen, wann er das Buch abschließen würde. Autor und Verlag (damals Rowohlt) legten deshalb, im Sog des Bachmann-Preises, mit Der Eisvogel zunächst ein ganz anderes Buch vor. Es wurde sehr zwiespältig aufgenommen: Tellkamp ging auf aktuelle Strömungen im Osten ein, beschrieb die Sogwirkung rechter, elitärer, militanter Intellektuellenzirkel, die mit Ernst Jüngerschem Waldgängerpathos die Pöbelherrschaft der DDR wie die kapitalistische Massendemokratie verachteten. Auffällig und in einzelnen Szenen sehr suggestiv war der Stil, der an die avancierte Ostmoderne eines Wolfgang Hilbig oder Reinhard Jirgl anzuknüpfen schien, seine glühende, aufgeladene Sprache.
Nun endlich erscheint Der Turm, das seit 2004 erwartete Opus magnum Tellkamps. Es geht chronologisch um einige Jahre zurück, endet 1989 und liefert nebenbei auch eine Vorgeschichte des Eisvogels, denn eine sehr deutsche, sehr abgeschlossene Welt tritt uns auch hier entgegen. Noch aber ist sie vornehmlich nach innen gewendet. Zu Beginn fährt der jugendliche Christian, der etliche biografische Daten mit dem Autor Tellkamp zu teilen scheint, Anfang der achtziger Jahre von seinem Internat übers Wochenende nach Hause. Er benutzt die Standseilbahn hinauf in ein altes, bürgerliches Dresdener Villenviertel und liest dabei einen Band mit »Alten deutschen Dichtungen«, zum Beispiel die Geschichte vom Goldsporenritter, der mit zweiundsiebzig Schiffen ausgezogen ist, um Königin Bride zu freien – darin findet sich Christian selbst wieder.
Die stillgelegte Zeit, die hier beschrieben wird, hat konkrete Daten. Es geht um ein Bildungsbürgertum, das in der DDR, speziell in Dresden im Stadtteil Weißer Hirsch, zu überwintern versuchte und eine deutsche Kulturtradition aufrechterhielt, die in der Bundesrepublik währenddessen verschwand. Der schillernde DDR-Wissenschaftler Manfred von Ardenne residierte hier mit seinem Privatinstitut (er taucht im Turm in der Figur des Barons Arbogast auf), und Schriftsteller wie Durs Grünbein oder Ingo Schulze, die nach 1989 auf irritierende Weise gleichermaßen zeitgenössisch und gebildet auftraten, waren in diesem Milieu groß geworden.
Tellkamps Figur Christian kommt aus dem Internat, um den fünfzigsten Geburtstag seines Vaters zu feiern. Dies ist ein klassischer bürgerlicher Höhepunkt und ein klassischer Romaneinstieg: Er zeigt Größe und bereitet den anschließenden Verfall vor. Christian spielt Cello, in einem Quartett aus Familienmitgliedern, er geht in diesem Cellospiel auf wie weiland Thomas Mann im Wälsungenblut.
Aber in dieser Dresdener Abendgesellschaft gibt es nicht nur Musik: Richard Hoffmann, der Vater, bekommt als Überraschung von den Ärztekollegen aus dem Klinikum sein Lieblingsbild eines zeitgenössischen Malers geschenkt. Und Meno, Christians Onkel, liebt alte Folianten und das Stöbern in unzugänglichen Antiquariaten; er arbeitet als Lektor in der feinen »Dresdener Edition«. Meno verfasst selbst heimlich Prosa und hat ein Leitmotiv: »Dresden…in den Musennestern / wohnt die süße Krankheit Gestern«. Liebevoll nennen sich die Bewohner des Viertels selbst »Türmer«, nach der zentral gelegenen Turmstraße, aber dass Goethes »Turmgesellschaft« aus dem Wilhelm Meister hier Pate steht, versteht sich von selbst.
Eine von den Zeitläuften losgelöste Kulturversunkenheit als Widerstand gegen die Zumutungen des DDR-Sozialismus – der Roman zeigt, wie diese Haltung zuerst gegen die DDR und dann auch mit der DDR untergeht. Literaturbeflissene Leser ahnen: Das ist der Buddenbrooks-Komplex. Dafür sind tausend Seiten der Maßstab, darunter geht es nicht. In lange und geduldig ausgesponnenen Handlungsfäden werden viele verschiedene Personen miteinander verbunden und streben gemeinsam dem Ende entgegen. Als Christian 16 ist, identifiziert er sich noch mit der vergleichsweise kleinen Erzählung über Tonio Kröger: »Wenn Christian durch die spärlich beleuchteten, nach Schnee und Braunkohlenasche riechenden Straßen ging, war ihm, als wäre er selbst Tonio Kröger, nicht ganz stilrein freilich, denn er war nicht der Sohn von steifleinenen Lübecker Patriziern.« Doch Christian will höher hinaus: »Mit 500 Seiten begannen die wirklichen Romane. Mit 500 Seiten begann der Ozean, drunter war Bachpaddeln.«
Uwe Tellkamps Roman endet bei ausgedruckten 975 Seiten. Der lange Atem ist Programm. Zunächst wird die bürgerliche Welt in den entsprechenden vergangenen Tönen ausgemalt, wir vertrauen uns einer längst verlorenen auktorialen Erzählhaltung an. Dann wird der bürgerliche Realismus beinahe unmerklich durch eine Art DDR-Realismus abgelöst, einer harten, ungeschönten Prosa mit Armee, Repression und Denunziantentum. So schonungslos, so radikal, so ohne Illusionen, in solch sozial- und alltagsgeschichtlich akribischer Weise wurde das Leben in der DDR bisher noch nicht dargestellt.
Die Mühen der Materialbeschaffung, die Lagermentalität und das allgegenwärtige Misstrauen – die DDR steht hier in ihren fast schon vergessenen Facetten wieder auf, mit ihrer Stasi-Atmosphäre und all ihren Sprelacart- und Wofasept- und Dederon-Depressionen. Der schwarze Schimmel, der sich in den alten Bürgerhäusern breitmacht und auch nicht mit Bootslack zu beseitigen ist, ist nur ein Vorbote, eine kleine Metapher für das Kommende.
Richard Hoffmann holt eine alte Stasi-Geschichte wieder ein, und seine Liaison mit einer Nebenfrau treibt immer wildere Blüten, bis zu einem Selbstmordversuch. Christian kommt direkt vom Cellospiel zur Armee, dem authentischsten DDR-Konzentrat. Meno wird immer tiefer in die Aporien der DDR-Literatur hineingezogen, und nebenbei entstehen Porträts von Möglichkeiten der DDR-Autorschaft, die nichts auslassen zwischen dummdreister Systembekräftigung, arrogantem Opportunismus, ausweglosem Lavieren und Verzweiflung. Wer will, kann unter anderem Franz Fühmann und Peter Hacks erkennen. So künstlich überzeichnet wie die altdeutsche Märchenwelt des Romananfangs, so kolportagehaft wirken mitunter die Handlungsstürze des Romanendes. Aber das, so führt es der Text vor, gehört zwingend zu seinem Stoff. Dieses Buch ist ein Monstrum, und es will ein Monstrum sein.
Natürlich hätten es keineswegs tausend Seiten sein müssen. Einige Kapitel wirken überflüssig, und manche scheinen einfach aus früheren Skizzenbüchern des Autors integriert worden zu sein. Sich wiederholende Passagen in Dresdner Mundart verselbstständigen sich, die Briefe des gerade einberufenen Soldaten verselbstständigen sich, die eingeschobenen Manuskripte Menos verselbstständigen sich. Ausgefeilte assoziative Passagen wie die über die letzte Dresdener Straßenbahnfahrt auf dem Weg zur Armee zeigen die Fähigkeit zur Verdichtung, zu einem elegischen, symbolischen Schreiben – aber sie deuten auch eine unangenehme Fallhöhe zu breiter angelegten, eindimensionalen Erzählperioden an.
Tellkamp hat offenkundig nach formalen Möglichkeiten gesucht, den realistischen Erzählstrom ab und zu zu stauen, Schleusen einzubauen, es gibt kurze Einschübe, die fragmentarischer, »zeitgenössischer« daherkommen. Dennoch wirkt das Buch insgesamt so, als ob es die jeweils beschriebene Bewusstseinsebene – konservierte Bürgerlichkeit, Armeedrill, Pubertätswirren – mit den ihr entsprechenden sprachlichen Mitteln einfach abbilden möchte. So entsteht zwar eine Art Kaleidoskop, aber man hat den Eindruck, eine letzte Überarbeitung – vor allem auch beim schwachen Schluss! – hätte dem Roman gutgetan.
Der Turm ist eine gewaltige Kraftanstrengung, ein abschließender Blick auf die DDR, der groß angelegte Selbstvergewisserungsversuch eines bedeutenden Autors. Dass »deutsche« Themen, die in Westdeutschland in Zusammenhang mit der 68er-Bewegung »bewältigt« wurden, auf dem Territorium der DDR immer noch virulent sind, wird in diesem Roman sehr beredt. Es geht um Innerlichkeit, um individuelles Pathos, um Schicksal. Das Buch ragt aus der üblichen Saisonware deutscher Gegenwartsliteratur weit heraus. In der Beschreibung der kleinen DDR-Welten, der Ängste und Zerstörungen, in der Analyse einer Diktatur entwickelt es mitunter einen starken Sog.
Vielleicht aber kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem Uwe Tellkamp eine zweite Fassung dieses monumentalen Werks vorlegt – analog etwa zu Gottfried Keller, der durchaus einer seiner Gewährsmänner sein könnte und der seinen großen Bildungsroman Der grüne Heinrich nach einiger Zeit überarbeitete, den ihm unheimlich gewordenen jugendlichen Überschwang ein bisschen zurücknahm. Kenner werden dann beim Autor Tellkamp wohl ähnlich augenzwinkernd wie jetzt die Kenner Kellers auf die erste Fassung verweisen: Hier sei das Werk noch im genialischen, rauschhaften Rohzustand, hier sei noch nichts geglättet. Sie haben eine unberechenbare Eigendynamik, die Musennester.
Frankfurter Rundschau
24-9-2009
Literatur
Im Dresdner Musennest
VON SABINE FRANKE
Uwe Tellkamp:
Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M., 976 S., 24,80 Euro.
In einer Zeit, in der der deutschen Gegenwartsliteratur oft vorgeworfen wird, zu wenig "welthaltig" zu sein, handelt der neue, gewaltige Roman des 1968 geborenen Autors Uwe Tellkamp über fast 1000 Seiten von einer kleinen Insel. Man befindet sich in Dresden, es sind noch sieben Jahre bis zum Untergang der DDR, die Rede ist von einem Wohnviertel hoch über der Stadt mit malerischen Villen hinter verschnörkelten Jugendstilzäunen, eine verträumte Welt voller "Sandstein-Schneckenwedel", Tapetentüren und versteckten Wintergärten. Die Gebäude tragen Namen wie "Delphinenort" oder "Felsenburg", und es sind die letzten Elfenbeintürme des Bildungsbürgertums, das in der DDR eigentlich ein Anachronismus sein sollte. Hier ist man unter sich: Mediziner, Literaten, Physiker, Musiker, der VEB-Fabrikdirektor - abgeschottet, eingeengt, aber behaglich eingerichtet in diesem Rückzugsgebiet einer aussterbenden und gleichwohl wie wild blühenden Elite, die es so bald darauf nicht mehr geben wird: Wie auf trutzigen alten Schiffen steuern die Bewohner in diesen Häusern dem drohenden Untergang ihrer Insel entgegen.
Christian Hoffmann will Arzt werden wie sein Vater Richard, der als
Unfallchirurg in einer Dresdner Klinik arbeitet. Es ist das Jahr 1982, und der
aknegeplagte Schüler schäumt vor Ehrgeiz und Bildungseifer fast über. Nebenbei
muss er üben, wie man "Rotfront argumentiert", ohne seine wahre Gesinnung zu
offenbaren - ein Erziehungsprogramm seines Vaters, dem dies selbst jedoch nicht
immer besonders gut gelingt.
Der Schwager Meno Rohde hat dagegen in jahrelangem "geschickten Wellenreiten
durch die Paternosteraufzüge" die Kunst der Unverbindlichkeit perfektioniert.
Als junger Naturwissenschaftler noch für ideologisch ungeeignet befunden und aus
der "sozialistischen Zoologie" entlassen, ist er nun Lektor eines wichtigen
Literaturverlags und in höchsten Autoren- und Nomenklaturazirkeln unterwegs.
Vom Vater lernt Christian, dass man wendig sein muss, wenn man seinen Kopf
retten will. Von Meno lernt er den genauen Blick und das leidenschaftliche
Bemühen um präzisen sprachlichen Ausdruck. Denn Meno schreibt: an einem
wuchtigen Gesang der mythisch werdenden Erinnerung, einem tiefgängig
verklausulierten, poetisch mäandernden Prosatext, wie er vielleicht typisch für
eine Art inneres Emigrantentum der DDR erscheinen mag. Menos Aufzeichnungen
stellen neben Christians und Richards Blickwinkel die dritte Perspektive in dem
vielgestaltig aus Briefen, Träumen, Rückblenden, Fakten und konventionellen
Erzählpassagen konzipierten Roman dar.
Um diese drei zentralen Figuren rankt sich ein weit verzweigtes Geflecht von
Angehörigen, Freunden, Kollegen und Kontrahenten. An bunter Welthaltigkeit
mangelt es also nicht - genannt seien ein hofierter, aus dem englischen Exil in
die DDR zurückgekehrter jüdischer Autor, Arbeiter aus einer Karbidfabrik und
zwei ehemalige Voltigierreiterinnen des Zirkus Sarrasani. Der Roman erschöpft
sich jedoch auch nicht in Milieus und Weltanschauungen. Es geht ebenso um die
Wahrnehmung der Zeit, die gebremst dahinzufließen scheint, selbst die Elbe,
"graubraun geschuppt, glich einem Saurier, der träge vorwärtskroch".
Im Land mehren sich Versorgungsengpässe und Stromausfälle, man weiß von
Ausreiseanträgen, erfährt von Selbstmorden, unter Freunden werden Witze über die
alten Herren an der Regierungsspitze gerissen, Zeile für Zeile analysiert man
Nachrichten aus Moskau in der Hoffnung auf Wandel, und doch verhält man sich
abwartend und müht sich, mehr oder weniger resigniert, menschlich und beruflich
redlich zu bleiben und das Beste zu geben. Man konzentriert sich auf das, was
man hat, was vor allem heißt, aufs Detail zu achten: "Die Türmer hörten
Tannhäuser in sieben verschiedenen Aufnahmen und verglichen sie miteinander."
Literatur, Malerei, Theater, Musik, all das wird ausführlich zelebriert,
manchmal so sehr, dass man, etwa beim ausufernden Gewese zum 50. Geburtstag von
Vater Hoffmann, ungeduldig einwerfen möchte: Leute, das aufwändig beschriebene
Essen wird kalt! Aber hier läuft eben niemandem die Zeit davon, alles wird bis
in die letzte Nische auserzählt - typische Symptome des Inseldaseins.
Harmlos ist das längst nicht mehr, insbesondere Christian ist von der "süßen
Krankheit Gestern" befallen, wie eine Droge braucht er das bürgerliche Idyll. Er
denkt in den Schablonen, die ihm in Opern und Romanen vorgegeben wurden, und
bringt, etwa, als er sich das erste Mal verliebt, den Brückenschlag zum wahren
Leben nicht zustande. Dabei wird der Raum für Eskapismus zunehmend begrenzter
und die Ausweichbewegungen werden immer verzweifelter. Wer fremdgeht, wird damit
erpresst, wer sich im Schuppen ein Fluchtflugzeug zusammenbastelt, "ä
rischtsches Fluchopp-jekt", wird verhaftet.
Auch Christian kommt, kaum dass ihm der begehrte Medizinstudienplatz zugeteilt
ist, unter die Räder. Nach üblen Drangsalierungen bei der Armee landet er im
berüchtigten Schwedt zum Strafarrest und als Arbeiter in einem chemischen
Betrieb, wo er unter menschenunwürdigen Zuständen schuftet.
Hier ist er fern von der vertrauten Welt, die träumerisch ein versunkenes
Dresden heraufbeschwört, ein versponnenes und verkrustetes Atlantis, und die
auch für die real existierenden Orte der Gegenwart verbrämte, verwunschene
Ortsbezeichnungen pflegt: Dinge gehen vor in "Laurasien", "Westelbien" und
"Ostrom", auf der "Kupferinsel" und im "Tausendaugenhaus". Es wird mythisch
gesprochen, um zu verschleiern, aber auch um dem Märchenhaften Geltung zu
verschaffen, Stimmungen zu fixieren, die weichen, vagen Züge der Realität, die
sich in einem Land, wo das Objektive einzig und allein das Parteiische ist, im
Bereich des Subjektiven und potenziell Unwirklichen bewegt.
Was nicht heißt, dass Tellkamp sich nicht an Faktisches hielte. Geradezu
lückenlos wirkt die Dokumentierung des DDR-Lebens, nichts scheint zu fehlen, das
Anstehen vor den Geschäften, die Urlaubsreise an die Ostsee mit FKK-Episode, der
Behördentag. Alles kommt derart vollständig daher, dass sogar Tellkamp selbst
auftritt, flüchtig in einer Nebenrolle als Krankenhausarzt. Und mehr noch:
Ähnlich wie Christians Lieblingslektüre, Stefan Zweigs "Die Welt von gestern",
ist auch Tellkamps Roman "ein Buch, das von einer lange versunkenen Zeit …
erzählte. Es wimmelte darin von Namen, Anspielungen, Zitaten, … ein
Wiedererkennungseffekt, der ihn begeisterte".
So ist "Der Turm" nicht nur ein episch angelegter Familienroman, sondern auch
ein fein gearbeiteter, genau erinnerter und recherchierter Geschichtsroman, der
sich an der Wirklichkeit entlangarbeitet. Christian trägt Spuren von Tellkamps
eigener Biografie, zudem hat "Der Turm" Züge eines Schlüsselromans. Bis in
scheinbar unbedeutende Nebensächlichkeiten ist er präzise nach realen Personen
und Vorkommnissen modelliert, sodass sich ein Insiderpublikum auf
Wiederbegegnungen mit alten Bekannten freuen kann, von Manfred von Ardenne
(Vorbild für die Romanfigur des Baron Arbogast) bis zu Carola Gärtner-Scholle
(im Roman Karlfriede Sinner-Priest).
Doch geht es nicht um Aufdeckung, sondern darum, Geschichte mit den Mitteln des
Romans anschaulich, erfahrbar und plausibel zu machen. Tellkamp betrachtet
Geschichte und Mythos von innen und außen, zu einer Zeit, in der die Geschichte
gerade erst zum Mythos wird.
Es ist ein Buch für Insider, Erinnernde, die selbst dabei waren, wie es auch ein
Buch für die Nach- und Nebenwelt ist, die Nacherlebenden, für die dieser Teil
der Geschichte immer etwas Erzähltes und nur von außen Betrachtbares bleiben
wird. Tellkamp hat der deutschen Literatur frei von Bitterkeit und Ressentiments
einen Erfahrungsschatz schriftlich gesichert, der unbedingt erzählenswert war,
nicht zuletzt deshalb, weil er uns sonst möglicherweise unmerklich wieder
entglitten wäre.
Der Stil der Dresdner sei immer der Stil der Alten gewesen, sagt Baron Arbogast
einmal, und so ist es nur konsequent, dass der Roman in der eleganten,
gediegenen und nicht zuletzt eigentlich überkommenen Sprache des klassischen
bürgerlichen Familienromans geschrieben ist. Bis ins Feinste ausziseliert,
bisweilen assoziativ ins Lyrische ausufernd oder genüsslich ins
Karikaturistische überdehnt, mit sächsischem Dialekt gewürzt und subversiven
Witzen gespickt - Tellkamp zieht viele Register. Virtuos hat er den
reichhaltigen Stoff kontrolliert bis zuletzt, wo im furiosen Gewirr der Stimmen,
Rollen und Perspektiven eine Ära endet, im Chaos des Wendeherbstes, als
jahrelang Aufgestautes sich Bahn bricht und dem Sozialismus seine letzte Utopie
nimmt: den Stillstand.
Christian ist zuletzt ein Mensch, der zwar Regungen verspürt, aber keine
Richtung sieht. Fast unmerklich geraten er und die Seinen aus dem Blick, während
die Masse alles überrennt. Und doch wollen diese Figuren nicht verschwinden.
Dringlich bleibt der Gedanke, wie es ihnen ergehen mag, wohin es sie treibt,
welche Richtung sie einschlagen. Nicht von ungefähr endet dieser bedeutende
Roman mit einem Doppelpunkt im Offenen. Gäbe es einen zweiten Band - man würde
ihn sofort lesen.
11. Oktober 2008, Neue Zürcher Zeitung
![]()
Beatrix Langner
Uwe Tellkamp: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 2008. 976 S.
Herbst 1988 in Dresden. Geschlossene Gesellschaft in der Gaststätte «Sibyllenort». Ein boshafter, verlogener, armseliger Haufen «Übriggebliebener»: SED-Parteisekretäre in Ritterkostümen, Dichter mit Eselsköpfen, Pionierleiterinnen mit blauen Dreieckskappen, Zahnärztinnen mit geschulterten Backenzähnen, ein jüdisches «Opfer des Faschismus» im Kostüm Augusts des Starken: ein Panoptikum von Endzeitgestalten, grotesk wie von George Grosz gezeichnet, die sich auf das Buffett stürzen, während eine Tanzkapelle Evergreens spielt. Doch völlig unvermittelt wechselt das Licht, sinkt die Temperatur tief unter null, geht die Szene in eine andere über. Deutsche Panzer rollen auf Moskau, Blut im Schnee, eine getötete russische Partisanin, an den Bäumen gehenkte Juden. Das ist der Totentanz der Geschichte, das makabre Rondo der politischen Kämpfe, die ihre Legitimität aus begangenem Unrecht beziehen, auf das sich immer neues Unrecht türmt.
Zum ersten Mal hat sich ein deutscher Schriftsteller an einer geschichtsphilosophischen Deutung der «friedlichen Revolution» in der DDR versucht. Das ist insofern ungewöhnlich, als erlebte Geschichte und historische Gerechtigkeit selten zusammengehen. Uwe Tellkamp, geboren 1968 in Dresden, ist Zeitzeuge. Doch er wollte das Ganze zeigen, die historische Totalität des Epochenbruchs, nicht nur den persönlichen Ausschnitt, und zwar in einer symbolischen, gleichnishaften Erzählweise.
Der stacheldrahtumzäunte Verwaltungsbezirk, die «Kohleninsel», die streng bewachte Gelehrtenrepublik der Grosskopfeten, die Parteizentrale in «Ostrom», das bürgerliche Turmstrassenviertel, alles verbunden durch schmale Brücken und Stege und getrennt durch «Rosenschlucht» und «Schwarze Schwester», ein von Abwassereinleitungen vergiftetes Flüsschen. Eine Miniatur-DDR, sozialistisches Atlantis, zeitgeschwärztes Utopia, todgeweiht durch seine geografische Lage in Ostelbien, politisch angeschlossen an das «Meer, das die Sozialistische Union umschloss, das Rote Reich, den Archipel, durchädert, durchwachsen durchwuchert von den Arterien Venen Kapillaren des Stroms, aus dem Meer gespeist», in dem es schliesslich untergehen wird.
Bereits der Eintritt in den Roman, dessen dramatischer Gestus stark an Alfred Döblin erinnert, ist wie der Tauchgang in eine von chemischen Trübungen verdunkelte Unterwassertopografie, in der man lesend nach Luft ringt, ein endzeitliches Panorama, aus dem sich nach und nach einzelne helle Gestalten lösen. Die Familien Rohde und Hoffmann mit ihren halbwüchsigen Kindern Christian, Robert, Muriel, Fabian. Dazu Nachbarn, Freunde, Hausbewohner des Turmstrassenviertels, in dem die Häuser so poetische Namen wie Tausendaugenhaus und Karavelle tragen und die Strassen Lindleite, Wurmleite, Wolfsleite heissen. Die «Türmer» gehören zur intellektuellen Elite Dresdens: Chirurgen, Verlagslektoren, Kombinatsdirektoren, Rechtsanwälte, deren hoffnungsvolle Sprösslinge Cello spielen, Thomas Mann und Eichendorff lesen und sich auf ihr Hochschulstudium vorbereiten. Aus dem Familienkreis ragen zwei hervor, der Abiturient Christian Hoffmann, die mehr leidende als handelnde Hauptfigur des Romans, und sein Onkel, der grüblerische Lektor Meno Rohde. Meno führt gewissermassen dem Autor das poetische Wort, während dieser sich um den Fortgang der weitverzweigten Handlung kümmern muss, die von 1982 bis zu den Tumulten auf dem Dresdener Hauptbahnhof im Oktober/November 1989 reicht.
Grundiert von DDR-typischem Pathos und bürgerlicher Patina, hebt sich Christians Geschichte klar und scharf von den Mystifizierungen ab, die Meno Rohde im DDR-Schriftstellerverband und im Forschungsinstitut des Barons von Arbogast begegnen (Manfred von Ardenne, Stefan Heym, Peter Hacks, Jürgen Kuczynski u. a. zur Kenntlichkeit verfremdet). Meno ist der einzige Bescheidwisser unter den Türmern, desillusioniert bis in die Syntax seiner tief dekadenten Monologe. «Hütet euch vor Ländern, in denen Gedichte hoch im Kurs stehen.» Aggressiv und gründlich entlarvt Tellkamp den Mythos von einer intellektuellen Opposition im Innersten der DDR-Gesellschaft, für die seine «Türmer» stehen. Mehr noch, er spricht sie schuldig an der Zerstörung von Lebensläufen. Denn die eigentliche Tragödie bestand darin, jung zu sein in einem Land, in dem alles alt war und die Uhren stillstanden. Mit entsetzlicher Wucht trifft sie die Kinder der Türmer, Christian und seine Cousine Muriel. (Eine Vorstufe des Romans, für die Tellkamp 2004 den Bachmann-Preis erhielt, trug den Titel «Der Schlaf in den Uhren».)
Ihre Eltern, die «sozialistischen Glasperlenspieler», beugen sich selbstgerecht «über den Geist der Goethezeit» und perfektionieren ihre Lebenslügen. Die Kinder wandern unterdessen jahrelang durch Jugendwerkhof (staatliches Umerziehungslager), NVA-Kaserne, Militärknast und Arbeitslager, um zu «allseitig gebildeten Persönlichkeiten» abgeschliffen zu werden. Während Muriels Lebensweg nur gestreift wird, ist Christian Hoffmann der tragische Held dieses Romans, der als makabres Gegenbild des guten alten bürgerlichen Bildungsromans Schritt für Schritt der Destruktion einer Persönlichkeit folgt. Die scheinheilige Bürgerlichkeit der «Turmgesellschaft» hat ihn gelehrt, sich nach aussen anzupassen, die Uniformen der FDJ, der Armee anzuziehen, während er sich innerlich sagt: «Ich trage diese Kleidung [. . .] und ihr habt trotzdem keine Macht über mich.» Ein gefährlicher Trugschluss! Nach brutalen Misshandlungen, Demütigungen und Verurteilung durch ein Militärgericht zu zwölf Monaten Haft weiss Christian, «dass er nun im Innersten des Systems angekommen sein musste»: in der Dunkelzelle.
Und während sein Neffe noch in dieser Einzelzelle schmort, vertieft sich Meno Rohde in Studien über den Aufbau der menschlichen Körperzelle und schliesst sich den Ausreisenden an. Wie einst Jarno, die charismatische Figur aus Goethes Altersroman «Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden», entsagt er der Literatur. Jarno war es auch, der die philanthropische Turmgesellschaft aus «Wilhelm Meisters Lehrjahren», in der die schönen Träume einer durch Kunstsinn und Bildung zu schaffenden bürgerlichen Nation gepflegt wurden, in die kapitalistische Zukunft der Neuen Welt führte, ein kleines Grüppchen ausgewanderter Technokraten. Für Christian kommt Menos Einsicht allerdings zu spät.
In der Berliner Ausgabe von Goethes Werken, in den frühen 1960er Jahren im Druckhaus Maxim Gorki im sächsischen Altenburg hergestellt, schildern 1145 grossmeisterliche Seiten den Anbruch des bürgerlichen Zeitalters. Uwe Tellkamp brauchte immerhin nur 976 Seiten für den Epochenbruch von 1989. So gesehen ist «Der Turm», diese grosse Tragikomödie eines irregeleiteten Landes, ein verspäteter, ein nachgeholter Vatermord.
![]()

Von Julia Encke
16. September 2008 Beinahe hätte man aufgegeben, war schon wieder kurz davor, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen nach den ersten fünfzig Seiten von Uwe Tellkamps neuem Roman „Der Turm“, der so mäandernd und so pathetisch beginnt, dass man gar nicht anders kann, als sich an den „Eisvogel“ erinnert zu fühlen, Tellkamps ersten Roman, mit dem der ehemalige NVA-Panzerfahrer, Arzt und Schriftsteller nach seinem Auftritt beim Literaturwettbewerb in Klagenfurt vor vier Jahren bekannt wurde. „Ich glaube, wir haben einen großen Autor entdeckt“, hatte Iris Radisch in Klagenfurt ausgerufen.
Und man verstand es nicht. Weder vor dem Fernsehbildschirm der Wettbewerbsübertragung. Noch, später, bei der Lektüre des „Eisvogels“. Denn Tellkamps Debüt, das ein Gesellschaftsroman hätte sein können, ließ, erzähltechnisch, jede Distanz vermissen. Es hielt keinen Abstand zu seinen Figuren. Und da diese Figuren zwei ressentimentbeladene junge Schnösel waren, die, demokratieverachtend, deutschtümelnd und elitär, gegen die eigene Zeit, das Land und die abgehalfterte Linke wetterten, atmete der Roman unwillkürlich selbst den Geist der Reaktion, den der Autor mit so viel Naturpathos unterlegte, dass er den Stereotypien seiner Figuren selbst anheimfiel.
Dann kommt die Überraschung
Wer die Ironie Flauberts liebte, konnte den „Eisvogel“ unmöglich mögen.Und jetzt, denkt man, geht das schon wieder so pathetisch los: „In der Nacht, die rostigen, die vom Mehltau des Schlafs befallenen, die von Säuren zerfressenen, die bewachten, die brombeerumrankten, die im Grünspan gefangenen, festgeschmiedet der Preußische Adler, die Schlag Mitternacht ihre Lauschtiere freilassenden, die hundertäugigen Periskope reckenden, Okulare scharfstellenden, bannertragenden, die von Schornsteinen geschwefelten, Musiklinien vortäuschenden, mit Bitumen bewalzten, von Tropfnässe Sicknässe Schwitznässe faulenden, die durch schimmernde Akten kriechenden, mit Stacheldraht betressten, mit Zifferblättern verbleiten Brücken . . .“ -Das ist nur ein Halbsatz auf Seite neun des neuen Romans. 967 Seiten hat man zu diesem Zeitpunkt noch vor sich, kann nach diesem halben Satz, der noch einmal so lang weitergeht, aber eigentlich schon nicht mehr.
Das Überbordende der obsessiv verwendeten Adjektivpartizipien macht einen fertig. Man will nicht hinein in Tellkamps „Turm“, macht Pause, regt sich wieder ab - und liest nur deshalb weiter, weil es sich bei diesem langen Satz aus der „Ouvertüre“ des Romans um zitierte Rede handelt: um einen kursiv gesetzten Auszug aus den Aufzeichnungen eines der Protagonisten Tellkamps, des vierzigjährigen Meno Rohde, der, wie man später erfährt, einen Monat nach Breschnews Tod, also im Winter 1982, in Dresden als Lektor eines Verlags arbeitet. Ausgestellte, zitierte Rede: das war eins der erzähltechnischen Distanzsignale, die man im „Eisvogel“ vermisst hatte. Also gibt man dem „Turm“ eine Chance. Warum auch nicht? Dann kommt die Überraschung: Aus dem völlig überladenen Anfang schält sich allmählich der eigentliche Roman heraus. Gegen alle Widerstände gerät man in den Sog einer anderen Zeit, folgt gebannt den wie abgelauscht wirkenden Gesellschaftsdialogen, die an manchen Stellen sogar komisch sind, was man von Tellkamp bisher nicht gerade kannte. Es ist, wie wenn der Autor sich den Weg der eigenen Erzählung durch das Gestrüpp der zu oft beschriebenen Dresdner Rosen- und Brombeerbüsche erst einmal habe bahnen müssen, um selbst hineinzukommen in sein Epos.
Tellkamp seziert diesmal
Es dauert eine Weile, dann liegt der Blick frei. Mit seiner „Geschichte aus einem versunkenen Land“, wie „Der Turm“ im Untertitel heißt, hat Uwe Tellkamp einen eindrucksvollen Roman über den Untergang der DDR geschrieben: Er beginnt 1982, endet am 9. November 1989 und konzentriert sich auf eine kleine Außenseitergruppe, die während dieser Jahre in einem Dresdner Villenviertel lebt. Es sind Menschen, die es im Sozialismus eigentlich gar nicht hätte geben sollen und dürfen, Bildungsbürger, die, dornröschenhaft im Abseits lebend, Hausmusikabende veranstalten, an den Humanismus und die freie Rede glauben, die sich abschotten in einer auf Goethes „Wilhelm Meister“ anspielenden „Turmgesellschaft“, um sich innerhalb dieser selbst gewählten Abgrenzung die letzten Freiräume erhalten zu können.
Die drei Protagonisten, deren Weg Tellkamp in den letzten DDR-Jahren verfolgt, sind einem dabei nicht unbedingt sympathisch. Aber gerade das macht den Roman überhaupt so interessant. Denn Tellkamp seziert diesmal. Er stellt dar, was in einer Zeit des lähmenden Stillstands, des Redeverbots, Systemdiktats und der Bespitzelung mit Menschen passiert: Der Lektor Meno Rohde, der in den Kreisen der „roten Aristokratie“ verkehrt, zieht sich immer mehr in sich selbst zurück, bunkert sich ein zwischen Manuskripten und Büchern, nimmt in Gesellschaft kaum mehr Stellung, um sich irgendwann ausschließlich seiner zoologisch-biologischen Leidenschaft zu widmen: der Erforschung der Zelle als „kleinste Einheit des Lebendigen“.Sein Schwager Richard Hoffmann, bekannter Chirurg an der Dresdner Klinik und, anders als Meno, kein Einzelgänger, nimmt sich, trotz gebotener Vorsicht, seine Freiheiten, die für ihn vor allem amouröse sind, führt ein Doppelleben, kündigt donnerstags an, gewohnsheitsmäßig schwimmen zu gehen, um in Wirklichkeit seine zweite Familie zu besuchen: Seit Jahren unterhält er eine Liebesbeziehung mit der Chefsekretärin des Klinikrektorats, von der er ein Kind hat. Als die Stasi ihn erpresst, droht er alle seine Lebensmenschen in den Abgrund zu ziehen.
Zwischen Wahrheit und Lüge
Und dann ist da noch Christian, Richards Sohn, die interessanteste Figur dieses Gesellschaftsromans: zu Beginn des „Turms“ siebzehn Jahre alt, schwer pubertierend, mit pickligem Gesicht und schwülstigen Träumen von „im Irrgarten der Liebe herumtaumelnden Kavalieren“ und der Achselhöhle seiner Klassenkameradin Reina. Er ist intelligenter als die anderen, ein verbissener Streber und hübscher, als er selber anzunehmen wagt. Sein Schicksal: Kind freiheitsliebender Eltern der Turmgesellschaft zu sein. Der Spagat zwischen anerzogenem Wahrheitsanspruch und notwendiger Lüge wird für ihn zur Zerreißprobe: „Aufrichtigkeit, auch und gerade dann, wenn es brenzlig wurde, war er nicht so von seinen Eltern erzogen worden? Gleichzeitig übten sie mit ihm das Lügen . . .“
Tellkamp schickt ihn nach dem Abitur zur Volksarmee, lässt ihn bei den „Panzern“ dienen, wo er es als „Brille“ nicht leicht hat und nicht anders kann, als aufzubegehren: Nach wiederholten staatsfeindlichen Äußerungen landet er im Gefängnis und dort, eine ganze Woche lang, als ausgelöschtes Individuum, in einer dunklen isolierten Zelle: „Er war in der DDR, die hatte befestigte Grenzen und eine Mauer. Er war bei der Nationalen Volksarmee, die hatte Kasernenmauern und Kontrolldurchlässe. Er war Insasse der Militärstrafvollzugsanstalt Schwedt, hinter einer Mauer und Stacheldraht. Und in der Militärvollzugsanstalt Schwedt hockte er im U-Boot, hinter Mauern ohne Fenster. Jetzt, dachte Christian, bin ich wirklich Nemo. Niemand.“
Die wörtliche Rede ist Tellkamps Stärke
Indem Uwe Tellkamp seine Außenseiter aus dem „Turm“ in so unterschiedlichen Milieus agieren lässt - der Nationalen Volksarmee, der Dresdner Klinik und dem Verlagswesen mit seinen literarischen Zirkeln, der Leipziger Buchmesse oder der Zensurbehörde -, gelingt ihm tatsächlich die Darstellung eines Panoramas in einer genau umrissenen Zeit. Es sind die Dialoge und Gespräche der vielen in diesen Milieus zu Wort kommenden Personen, die den Roman dabei so reich und immer wieder auch spannend machen. Denn die wörtliche Rede, im Dialekt, in verknappter Umgangssprache oder akkuratem Hochdeutsch, ist Uwe Tellkamps Stärke. Sie haucht seiner Prosa das Leben ein. Dass er dabei auf selbst Erlebtes zurückgreift, ist für die Lektüre des Romans im Grunde nebensächlich: Wie Christian im Roman verpflichtete sich Uwe Tellkamp nach dem Abitur zum dreijährigen Wehrdienst in der NVA und wurde wegen „politischer Diversantentätigkeit“ auffällig, weil er Texte von West-Autoren und Wolf Biermann bei sich führte. Als seine Einheit 1989 gegen Oppositionelle, darunter Tellkamps Bruder, ausrücken sollte, verweigerte er den Befehl, wurde zwei Wochen lang inhaftiert und anschließend beurlaubt.
Es gibt, auf der Homepage des Suhrkamp-Verlags, einen Hörbeitrag, auf dem der Autor, zum Erscheinen seines neuen Romans, die Strategien seines Schreibens erklärt. Anton Tschechow sei ihm im Traum erschienen, erzählt er da und meint es ernst. Er habe ihm gesagt, welche Wörter er im ersten und im letzten Satz seines Romans streichen solle. Sie seien zu bedeutungshubernd, überflüssig, müssten weg. Tellkamp habe seinen Rat befolgt und auch im letzten Satz die eigentlich vorgesehene Erwähnung des „Falls der Mauer“ weggestrichen, um den „Turm“ offen mit einem Doppelpunkt enden zu lassen: „. . . aber dann auf einmal . . . schlugen die Uhren, schlugen den 9. November, ,Deutschland einig Vaterland', schlugen ans Brandenburger Tor:“ Hätte doch Anton Tschechow sich im Traum auch zu den mäandernden Passagen des langen, sich mühsam dahinziehenden Romananfangs geäußert, denkt man. Man wäre bereitwillig hineingegangen in den „Turm“.

15-10-2008
Uwe Tellkamp: "Der Turm". Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, 976 Seiten, 24,90 Euro
"Der Turm" von Uwe Tellkamp ist mehr als der lange erwartete große Wenderoman. Es geht um die Neuerfindung von gründlichem und dafür ruhig gelegentlich etwas umständlichen Erzählen.
VON DIRK KNIPPHALS
Großes Thema. Tausend Seiten. Und woran erinnert man sich nach dem Lesen als Erstes?
An Namen. Pastor Magenstock - der Name ist schon toll für einen Geistlichen, der mitten im Kommunismus unbeirrt und ein bisschen lächerlich das Christentum verkündet. Judith Schevola - schön für eine Schriftstellerin, die beim Regime aneckt. Außerdem gibt es Soldaten, die Irrgang heißen, und einen Kampfgruppenkommandeur Pedro Honich. Die Hauptfiguren aber tragen schlichte Namen: Richard Hoffmann, sein Sohn Christian, sein Schwager Meno Rohde.
Man erinnert sich an kleine Dinge wie die "Weihnachtsbaumabnahmekommission", die in einer Szene eine Rolle spielt, an den oft wiederholten Vers "Dresden OE in den Musennestern / wohnt die süße Krankheit gestern" oder an das "Enöff", mit der eine Tante leitmotivartig ihre Redebeiträge beendet - eine sächsische Version das englischen Wortes enough.
Und man erinnert sich zum Beispiel an die beseelte Art, wie Wanderungen bei Bad Schandau beschrieben werden ("Sonne rädelte über den Bergen hoch. Farn bekam rote Spitzen"); an die lakonisch erzählte Schülergrausamkeit, einem Frosch die Beine abzuschneiden; oder wie unsentimental die schweren Verwicklungen des Jugendlichen Christian Hoffmann mit den Behörden erzählt werden. Er hatte heimlich das Buch "Mein Weg nach Scapa Flow" des Nazi-U-Boot-Kommandanten Günther Prien gelesen, aus Tarnungsgründen eingeschlagen in die Junge Welt, und war dabei erwischt worden.
Es sind die Details also, an die man sich zuerst erinnert. Das ist gut so. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass es geglückt ist, beim Lesen jene willling suspension of disbelief herzustellen, jene gewollte Hintanstellung des Nichtglaubens, die laut einer angelsächsischen Romantheorie nötig ist, um die Eigenrealität eines Romans zu akzeptieren. Es sind ja in Wahrheit nicht viele Romane, die ein Autor schreiben kann (ist es nicht längst immer der gleiche Roman, den etwa Peter Handke schreibt?). Und an den Details erkennt man ganz gut, ob man es als Leser hier mit etwas Ausgedachtem zu tun hat oder mit etwas, was tiefe Wurzeln im Erleben besitzt und einem deshalb beim Lesen das Gefühl vermitteln kann, einen zutiefst satt zu machen. Die Details in Uwe Tellkamps Roman "Der Turm" erzeugen dabei sehr schnell den Eindruck, dass dies ein Buch ist, das geschrieben werden musste.
Alle einschneidenden Leseerlebnisse haben ihre eigene Geschichte. Bei diesem war zunächst von Widerständen zu berichten. Sie lagen an dem vorangegangenen Roman dieses 1968 in Dresden geborenen Autors. "Der Eisvogel", vor drei Jahren erschienen, kam total gestelzt daher - Möchtegernprosa, dann auch noch gewollt kulturkritisch. Auch wenn es eigentlich keine Rolle spielen soll: Das Auftreten dieses Autors ist auch nicht unbedingt vertrauenserweckend. Als er im vergangenen Sommer in Hildesheim zum ersten Mal aus dem neuen Roman las, trat er in einer Art Wandervogel-Outfit auf, wie aus der Zeit gefallen. Auch bei der Lesung im Literarischen Colloquium in Berlin wirkte er irgendwie linkisch. Und dann fängt "Der Turm" auch noch so getragen an. Mit einem kunstfertig hingewerkelten Prolog und dann einer ellenlangen Beschreibung der Ankunft in dem Dresdner Turm-Viertel, dem zentralen Handlungsort des Buches. Es brauchte drei Leseanläufe, um in den Roman hineinzukommen.
Aber dann hat mich das Buch gekriegt, und zwar auf Seite 54. Da geht es um Kammermusik. Richard Hoffmann, der Chirug, feiert groß seinen 50. Geburtstag, und sein Sohn Christian spielt ihm zu Ehren mit Freunden "das italienische Stück, eine Suite aus der Barockzeit, ursprünglich für Flöte vorgesehen, aber Niklas hatte die Flötenstimme für Klarinette eingerichtet". Es ist keineswegs der bildungsbürgerliche Habitus, der einen hier fesselt. Vielmehr versieht Uwe Tellkamp diese Stelle mit einem dramatischen Effekt. Christian reißt die a-Saite seines Cellos. Er muss das Stück also auf den verbliebenen drei Saiten spielen. "Alle Passagen, die er vor dem Malheur bequem und ziemlich entspannt hätte spielen können, waren urplötzlich zu technischen Husarenstücken geworden." Gerade einmal zweieinhalb Seiten lang ist diese Stelle. Aber ihre innere Spannung trägt einen als Leser noch lange Zeit.
Es gibt viele solcher Stellen in diesem Roman. In sich sind sie oft ganz ökonomisch gebaut, weshalb man es nur selten mit dem Gefühl zu tun bekommt, der Roman sei zu lang. Ein Ort wird beschrieben und dann eine Figur mit ihm in Beziehung gesetzt. Oder zwei Figuren gehen spazieren in diesem Alltagssetting aus den späten Jahren der DDR und reden miteinander. Dann gibt es auch innere Monologe, Naturschilderungen, satirische und groteske Szenen (unvergessbar: welche Talente zum Organisieren es brauchte, um über die Runden zu kommen).
Einmal, im Kapitel "Die Papierrepublik", wird auch eine Tagung des Schriftstellerverbands der DDR nur durch die Wortmeldungen ihrer Mitglieder beschrieben - inklusive vieler lustiger Insideranspielungen an reale DDR-Autoren (Peter Hacks!). Was die Gestaltungsvielfalt und Lust an den eingesetzten erzählerischen Mitteln betrifft, ist es gar nicht so falsch, als Referenzpunkt etwa an Herman Melvilles multiperspektivisches Meisterwerk "Moby Dick" zu denken. Nur zum Ende hin, wenn es die Schilderung der Vorgeschichte vom Mauerfall und damit Untergang der DDR geht, übertreibt Uwe Tellkamp ein wenig.
Irgendwann weiß man beim Lesen jedenfalls nicht mehr, was man erstaunlicher finden soll: das breite Spektrum an Szenen und Figuren, das Uwe Tellkamp hier ausbreitet, oder die erzählerische Fähigkeit, dieses Panorama tatsächlich zusammenzuhalten. Was dieser Roman unbedingt kann, ist, trotz seiner vielfältigen Elemente, eine innere Geschlossenheit zu bewahren. Familienszenen, Schulszenen, Krankenhausszenen, dann Stadtbeschreibungen, Porträts von Mitgliedern der Nomenklatura, dann auch noch Episoden aus dem Alltag bei der Nationalen Volksarmee und Elemente der Realgeschichte wie die Eröffnung der Semperoper - das alles bildet ein Mosaik, keinen Steinbruch. Und es ist interessant, dem nachzugehen, was diesen Roman zusammenhält.
Zum einen ist es das Milieu der "Türmer", jener Bewohner des Turm-Viertel also, das es in Dresden tatsächlich gibt. Man darf sich dieses Milieu bloß nicht als bewusst dissidentisch vorstellen. Eher geht es in ihm darum, eine gewisse Distanz zur Gegenwart zu pflegen, ein kleines Refugium des Privatlebens in einem Land, in dem alles politisch aufgefasst wurde. Das ist für einen Roman von großem Vorteil, so können die verschiedenen Grade der Einbindungen ins Regime, der Versuchungen, auch der inneren oppositionellen Haltung bei äußerer Beteiligung dargestellt werden. Zudem ist dieses Milieu auch für sich interessant. Eine privilegierte Nischengesellschaft in alten Villen, die auch unter erschwerten Bedingungen die Traditionen des deutschen Bildungsbürgertums pflegt. "Wissen war, was zählte; Wissen hieß der gehütete Schatz derer hier oben." Das ergibt viel Material für differenzierte Figurenzeichnungen.
Zum Zweiten trägt das Interesse dieses Autors an der Schilderung von Lebensläufen. Sein Richard Hoffmann etwa hat das Zeug, zu einer bedeutenden Figur in der deutschen Gegenwartsliteratur zu werden (anders etwa als Enrico Türmer aus Ingo Schulzes Roman "Neue Leben"; der ist zu verquatscht). Dieser Richard Hoffmann ist Chirurg, guckt aber - ganz große Szene! - einmal über fünf Seiten fremd auf seine Hände; er ist wahrheitsliebend, betrügt aber seine Frau; er ist gefühlsgehemmt, muss aber an einer Stelle den jugendlichen Sohn seiner Geliebten ausgerechnet dann umarmen, als der ihn erpressen will (lakonischer Kommentar des Erzählers: "Erpressung im Stimmbruch hatte etwas Komisches"). Unendlich differenziert zusammengesetzt ist auch sein Sohn Christian Hoffmann, der sich am Anfang in die Außenseiterposition eines Tonio Kröger hineinträumt und dann mit der harten Realität in der NVA konfrontiert wird. Diese Figuren sind glaubwürdige Reflexions- und Spiegelfiguren für den Leser.
Das Dritte, was durch den Roman trägt, sind die durchgehenden Motive. Es wird viel Musik gehört, Romantik, Wagner, was einem bei aller erzählerischen Modernität dann und wann auch den Eindruck vermittelt, im Umfeld Thomas Manns gelandet zu sein. Noch viel eindrucksvoller durchgeführt aber ist das Motiv des Sehens. Ein Kapitel, in dem Schmetterlinge beschrieben werden, gerät ganz zu einer Schule des Sehens. Immer wieder werden passende Adjektive gesucht, um Farbnuancen ganz genau zu beschreiben. Das auch durchgehende Motiv der ablaufenden Zeit, mit dem erzählerisch auf den 9. November 1989 zugearbeitet wird, gerät dagegen ein wenig zu aufdringlich.
Es ist überhaupt selbstverständlich ganz richtig, dieses Buch als einen Roman über die untergehende DDR zu bezeichnen. Auf jeden Fall wäre es falsch, das gar nicht zu tun. Aber noch falscher wäre es, ihn nur als Wenderoman zu begreifen. Es gibt hier einen unbedingten Willen zum Roman und eine große Lust am ästhetischen Spiel immer neuer Erzählperspektiven, die weit über das Thematische hinausreichen. Uwe Tellkamps Literaturentwurf ist am Projekt einer Rückgewinnung des Epischen ausgerichtet, an der Neuerfindung eines gründlichen, genauen, sozusagen nachhaltigen und dafür ruhig gelegentlich auch etwas umständlichen Erzählens. Uwe Tellkamp will in einem emphatischen Sinn Erzähler sein.
Dieses Projekt gibt es derzeit in der Generation der 40- bis 50-Jährigen auch unter westdeutschen Autoren. Bei allen Verschiedenheiten kann man von "Der Turm" aus durchaus Linien ziehen zu Michael Kleebergs Roman "Karlmann", Ulf Erdmann Zieglers Buch "Hamburger Hochbahn" und in gewisser Weise auch zu Sven Regeners "Neue Vahr Süd" oder Gerhard Henschels "Kindheitsroman". Auch bei ihnen werden die Prozesse von Sozialisation und Individuation als unendlich komplexes und deshalb hoch spannendes Erzählmaterial aufgefasst. Was dann literarische Entdeckungsreisen ins angeblich Vertraute der näheren Umgebung ermöglicht. Während man Literaturnobelpreise offenbar nur noch kriegt, wenn man angeblich zwischen den Kulturen steht, versuchen diese Autoren, erst einmal das Terrain des Eigenen abzuschreiten - eine konsequente literarische Reaktion darauf, dass fremd wir uns selber sind.
Das kann der Roman: einen Rahmen geben für das Projekt, sich erzählerisch selbst auf die Spur zu kommen. Wie viel dieses Projekt immer noch hergibt, kann man bei Uwe Tellkamp nachlesen.

Uwe Tellkamp: Der Turm. Suhrkamp, Frankfurt. 976 S., 24,80 Euro.
Das wichtigste Buch des Herbstes: Der Schriftsteller Uwe Tellkamp legt ein grandioses Panorama vom Untergang der DDR vor. Auf fast 1000 Seiten begleitet sein Roman "Der Turm" das Bildungsbürgertum in Dresden – und führt tief hinein in die triste Geschichte eines Unrechtsstaates.
Und mindestens so atemberaubend ist die strukturelle Vielgestaltigkeit der Szenen. Kurzgeschichten, hat Tellkamp behauptet, könne er nicht. Im "Turm" beweist er das Gegenteil. Tellkamp verschränkt Erzählstränge, bricht sie auf, beschleunigt das Tempo und lässt die Zeit ganz langsam vorbeiziehen, springt in Briefausschnitte und wieder zurück in den Erzählfluss und baut Kapitel zu makellosen Kurzerzählungen aus. Die Wechsel in Stilebene und Erzählform nutzt er, um auch in die hinteren Winkel seines Panoramas zu spiegeln.
Nicht immer zwar, gerade am Anfang nicht, gelingt die geschmeidige Hereinnahme zeitgeschichtlicher Vorgänge in die Erzählung und vor allem in die Dialoge auf ähnlichem Niveau wie beispielsweise in Michael Kleebergs "Karlmann". Je länger, je mehr greift das Räderwerk aus Außen- und Innenwelt reibungsloser ineinander. Und ermöglicht Tellkamp grandiose, tiefenscharfe Kamerafahrten ins Innere eines untergegangenen Landes. Kamerafahrten, von denen man (als Westler) auch wieder einmal viel über die "prinzipielle Fremdheit der Lebenserfahrungen von Ost und West" (Tellkamp) lernen kann.
Vom beinahe surrealen Kampf gegen die aberwitzige Bürokratie und die überwältigenden Versorgungsnotstände. Vom geschickten Korrumpieren und dessen potenziell unendlichem Kreislauf. Von der Zurichtung der Menschen und der Brüchigkeit der Beziehungen unter dem Druck eines inhumanen Systems. Vom Aufblühen des subversiven Witzes (Frage: Kann man mit einer Banane die Himmelsrichtung bestimmen? Antwort: Man kann. Indem man sie auf die Mauer legt, wo später abgebissen ist, ist Osten). Von Byzantinismus und grassierender Ungerechtigkeit. Von Zensur und den perfiden Mechanismen der Unterdrückung unliebsamer Literatur.
Mit gut einem Dutzend Figuren hat Tellkamp sein Spielfeld der höchst unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Positionen besetzt, und er versteht es nahezu vollkommen, mit ihnen zu ziehen, sie gegeneinander zu ziehen. Es gibt Spitzel und Republikflüchtlinge. Einen beinhart stalinistischen Star-Dramatiker mit Neigung zum Dandy, eine kaltgestellte Nachwuchsstarautorin, eine besonders spießig-bösartige Zensorin, einen Großbürgersohn, der fest an einen dritten Weg glaubt, einen leibhaftigen adligen Industriellen, einen höchst geschickten Rechtsanwalt, der Sperber heißt und in der wirklichen Wirklichkeit wohl dem legendären Wolfgang Vogel entspricht, wie viele Figuren bis zur Unkenntlichkeit aus realen Personen der ostdeutschen Kultur- und Politgeschichte zusammengesetzt sind.
Und es gibt das zentrale Dreigestirn. Richard Hoffmann, der sich regelmäßig in Rage redet über die Zustände in seinem Land und an seiner Klinik, sich aber erpressbar macht mit seiner Stasi-Vergangenheit und seinen außerehelichen Aktivitäten.
Am Ende resigniert er, zerrieben zwischen Aufbegehren und Anpassen, verliert seine Frau und den Anschluss an die neue Zeit. Meno, der Chronist, begleitet seine Morgenlandfahrer, malt die Verlagslandschaft, malt sein Land in den dunkelglühendsten Farben aus, ist überall dabei, weiß, wie man sich verhalten muss, tut aber nichts. Ein Lektor, der nicht in die Geschichte eingreifen will. Christian hingegen, dessen Entwicklungsroman "Der Turm" eigentlich ist, rast immer die Spirale abwärts.
Der anfangs unsichere und reichlich unsympathische, großmannsüchtige Eliteinternatsschüler versucht sich zu wehren, das Erbe zu bewahren, zu nutzen, fährt dann durch die apokalyptischen Landschaften des Braunkohletagebaus und die lebensfeindliche Hölle einer Karbid-Fabrik, fährt ein ins so genannte U-Boot, durch mehrere Sprachverluste in eine lichtlose Einzelzelle, in der er sich endlich im Zentrum des Systems angekommen und bei sich fühlt, ganz unten, zum Niemand zerschrotet.
Wie unterschiedlich man doch die Untergangsgeschichte der DDR erzählen kann. Als Geschichte einer Vertreibung aus dem Paradies, wie es Ingo Schulze in "Adam und Evelyn" gerade getan hat, auf die Gefahr hin, von Ostalgikern grandios missverstanden zu werden. Oder eben als Blick in die sozialistische Vorhölle wie Tellkamp im "Turm", der nun wirklich nicht missverstanden werden kann. Obwohl der Großroman kein Pamphlet geworden ist, keine Abrechnung. Auch wenn Tellkamp durchaus Gründe dafür gehabt hätte, der Versuchung zur Rache nachzugeben.
Der Panzerkommandant der NVA (was er wurde, weil er Medizin studieren wollte) saß wegen "politischer Diversantentätigkeit" ein (er wurde in der Kaserne beim Sammeln von Gedichten unter anderem von Wolf Biermann und beim Lesen einer Hermann-Hesse-Biografie aus jenem Verlag erwischt, bei dem er jetzt erscheint, ist somit gewissermaßen Opfer der Suhrkamp-Kultur).
Im Oktober 1989 weigerte er sich mit seinem Panzer gegen die Dresdner Demonstranten auszurücken und kam wieder in den Knast, teilt also in einigem das Schicksal Christian Hoffmanns. Tellkamp richtet aber seine Figuren nicht, ironisiert sie höchstens, lässt sie reden, verfolgt sie wie mit einer Dogma-Kamera. Und verschafft ihnen so etwas wie geschichtliche Gerechtigkeit, schafft es, dass selbst die widerlichsten Gestalten aus den oberen Etagen Ostroms oder dem "Verband der Geistestätigen" noch in ihrer atemberaubenden monströsen Verdrehtheit bemitleidenswert erscheinen. Traurige Gesellen, die auf eine Biografie aus geplatzten Träumen, pervertierten Idealen zurückblicken und mit fast wahnsinniger Verblendung ihren Realitätsverlust fortschreiten lassen.
Am Ende schlagen die Uhren. Die Zeit von Atlantis ist abgelaufen. Die Papierrepublik zerrinnt. Die Mauer fällt. Und es bleibt kein Zweifel daran, was aus dem humanistischen Projekt, das die DDR am Anfang und für einige auch gewesen sein mag, am Ende geworden war. Kein Paradies. Ein Scheißstaat.