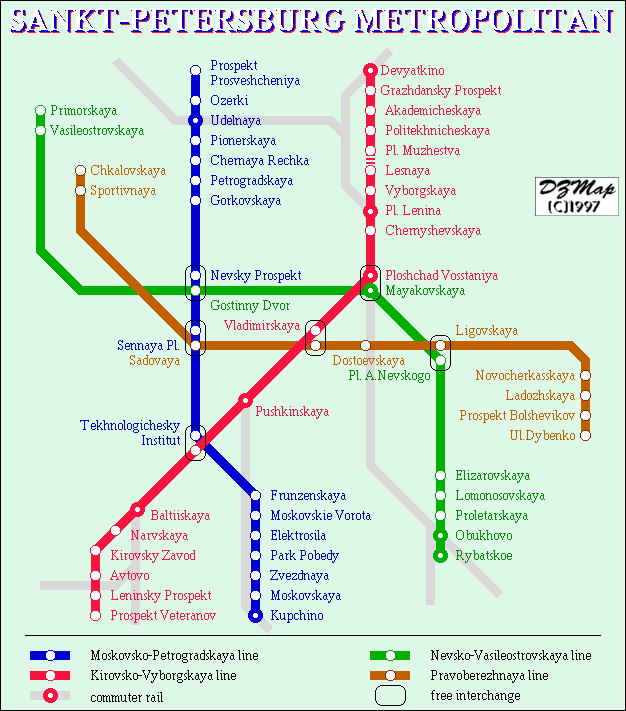
6-11-2003
St. PETERSBURG
N Z Z Online
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Als der Zar Peter im Jahre 1703 in der Newa- Mündung an der Ostsee eine Festung errichten und daneben unter dem Patronat des Apostels seines Namens eine neue Stadt erstehen liess, war dies Zeichen einer nie da gewesenen Hinwendung Russlands nach Westen - wider die orthodox- byzantinische Welt Moskaus, in der sich die Macht bisher geballte hatte. Das Ziel des weltoffenen und innovativen jungen Herrschers war es, Russland in ein den europäischen Grossmächten ebenbürtiges Imperium zu verwandeln. Nachdem die südliche Expansion ins Stocken geraten war und der Grosse Nordische Krieg einen militärischen und politischen Erfolg über Polen und Schweden gebracht hatte, bot sich dazu der mittel- und nordeuropäische Raum als Exerzierfeld des neuen Herrschaftsgedankens an. Folgerichtig avancierte St. Petersburg bereits 1712 zur Hauptstadt des russischen Reiches.
Im Geiste der Frühaufklärung hat Peter, nach einem berühmten Wort, den Russen «das Fenster nach Europa» aufgestossen. Planmässig gebaut indes wurde St. Petersburg erst nach dem Tod des Stadtgründers 1725 - auf einem Gelände, das (ähnlich Venedig) denkbar ungeeignet war für die Errichtung einer Stadt: grundwassernah, überschwemmungsgefährdet, mit einem Boden aus Schlick, ohne nahe Steinvorkommen. In der Wahl der Mittel war man ebenso unzimperlich wie distinguiert: Zwangsarbeiter aus allen Teilen Russlands wurden herangezogen - und das Beste, was es an zeitgenössischen internationalen Architekten und Stadtplanern gab. Die Adeligen mussten zunächst genötigt werden, an den unwirtlichen Ort überzusiedeln und dort ihre Residenzen zu errichten. Bald schon liessen sich Ausländer nieder. Das Ergebnis des Efforts überwältigt noch heute: In etwa 150 Jahren erwuchs unter immensen menschlichen Opfern aus den Sümpfen eine Stadt mit breiten Prachtstrassen, barocken und neoklassizistischen Schlössern und Palästen, gekrönt von Goldkuppeln und Turmhelmen, eine Architektur, die im Eklektizismus der Moderne eine dynamische Fortsetzung fand und dank ihrer Repräsentanz auch den Monumentalismus der Stalinzeit abzuwehren vermochte. Es war eine Pracht, die Herrscher, Hof und Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst gleichermassen zum Ruhm gereichte. Bereits die Zeitgenossen haben die klassische Epoche St. Petersburgs als kairos, als «Goldenes Zeitalter» des Fortschritts und der Rationalität, begriffen.
St. Petersburg wurde erbaut und erfunden. Durch den demiurgischen Akt ihrer Erschaffung ist die Stadt schnell zum Mythos ihrer selbst und zugleich zum massgeblichen Projektionsraum russischer Geschichte und russischen Selbstverständnisses geworden. Industrialisierung und Bevölkerungswachstum führten im 19. Jahrhundert zu einem flächendeckenden Ausbau, was zur Folge hatte, dass die prosaisch-bürgerliche, aber auch proletarisch-hässliche Seite des Fortschritts manifest wurde. Fremd indes war St. Petersburg als exzentrische Gründung immer schon gewesen: Gogol und Dostojewski haben den Ort als Metropole des Phantastischen und Absurden, der Verlorenheit und Armut geschildert. Der Körper in Stein, auf dem bisher aller Stolz geruht hatte, geriet literarisch in Verruf als kalte Herrschafts- und Entfremdungsmaschine und bald auch - in Kontrast zum kirchlich-klösterlich geprägten, ländlich- symbiotischen Moskau - ins Zentrum patriotisch- weltanschaulicher Debatten über die «Seele» Russlands.
War die Stadt den Slawophilen Sackgasse und Sündenfall, so den Westlern Zukunft und Offenbarung. Die historischen Erfahrungen von Autokratie und Erstarrung, gesellschaftlicher Zerrissenheit und Revolution taten ein Übriges, dass die Moderne vor allem von ihrer katastrophischen Seite her erfahren wurde (tatsächlich sollte später, anders als gedacht, manch poetische Apokalypse der Dichter wahr werden). In der Gleichzeitigkeit von zaristischer Macht, kapitalistischem Boom und proletarischer Mobilmachung gab die Stadt einen kaum weniger bedeutenden Schauplatz der Avantgarde ab als Paris, Wien oder Berlin. Noch einmal, in einem Moment rückschauender Kontemplation, im «Silbernen Zeitalter» der russischen Poesie, bei Anna Achmatowa und Ossip Mandelstam, wird das klassisch-reine Bild St. Petersburgs aufleuchten, bevor die Metropole, nach dem Tod Lenins 1924 in Leningrad umbenannt und bereits 1918 der Hauptstadtwürde enthoben, in den langen Schatten der sowjetischen Geschichte eintaucht.
Es war nicht so, dass die Stadt in der Folge der «Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution» von 1917 sogleich kulturell erdrosselt wurde. Bis in die späten zwanziger Jahre hinein liessen die sowjetischen Machthaber die zumeist utopisch- idealistisch gesinnten und mit der Verheissung eines «Neuen Menschen» sympathisierenden (experimentellen) Künstler gewähren. Dann aber begann der Dogmatismus der Staatsideologie sich in allen Lebensbereichen absolut zu setzen. Durch Zerstörung und Verbot, Verhaftung und Mord arbeitete das Regime erfolgreich an der Tilgung des kulturellen Gedächtnisses der Stadt, deren schierer Reichtum an Formen und Ideen es als gefährlich empfinden musste. In der Sowjetzeit wurde Leningrad kaltgestellt, indem es zu einer Hochburg des militärisch-industriellen Komplexes umfunktioniert wurde, die Bevölkerungszahl schwand rapid. An die Stelle des lebendigen Stadtmythos traten die Heraldik der kommunistischen Machtergreifung - eine propagandistisch aufbereitete Mischung aus Wunsch und Wirklichkeit, Wahrheit und Legende. Und doch blitzte an der Newa der Funke der Aufklärung bei aller Repression auch nach 1918 immer wieder auf: Vom Aufstand der Kronstädter Matrosen über die weitverzweigte Untergrundkultur der sechziger Jahre bis zum Massenprotest gegen den Moskauer Putsch des Jahres 1991 blieb Leningrad ein Kristallisationspunkt des Widerstands gegen die Parteidiktatur.
Im Zweiten Weltkrieg hat Leningrad einen extremen Preis bezahlt: Vom Herbst 1941 an wurde die Stadt für 900 Tage von der deutschen Wehrmacht belagert. Es herrschten bitterste Kälte und Hunger, fast ohne Unterlass schlugen Artilleriegranaten ein und fielen Bomben. 600 000 Menschen starben, der Süden der Stadt wurde völlig zerstört, die Innenstadt mit ihren Prachtbauten stark verwüstet. Nachschub an Waffen, Treibstoff und Verpflegung gab es nur über eine kleine Bahnstrecke im Nordosten und über das meterdicke Eis des Ladogasees. Der Widerstand und die Moral der Bevölkerung, ein Mischung aus russischem Patriotismus, Überlebenswillen und sowjetischer Disziplinierung, waren nicht zu brechen. Heute, da die totalitären Gespenster vertrieben sind, geht die Stadt unter dem früheren Namen daran, sich wieder zu erfinden - indem sie die eigene Geschichte den Archiven des Schweigens entreisst und sich alte Tugenden neu aneignet. Eine Metamorphose ist im Gange, die man im Westen noch wenig zur Kenntnis genommen hat. Das 300-Jahr-Jubiläum St. Petersburgs, dem wir hier in prismatischer Wahrnehmung vier Seiten widmen, stellt einen guten Grund dar, das Fenster aufzustossen - nach Osten, wo die Träume wohnen, die die unseren waren und noch immer sind.
Andreas Breitenstein
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Von Konstantin Asadowski
Es ist «unnatürlich, eine grosse Stadt zu sein», meinte Rainer Maria Rilke. Für Petersburg gilt das in ganz besonderem Masse. Unter den grossen Städten der Welt zeichnet Petersburg sich durch sein ungewöhnliches Schicksal aus. Die Stadt entstand in einem Zuge, nach dem Plan eines einzigen Mannes, der ein barbarisches Land nach westeuropäischem Vorbild umformen wollte. Petersburg wurde gewaltsam erbaut: gegen das übrige Russland. In der neuen Hauptstadt des russischen Imperiums siedelten sich Ausländer an - Deutsche, Holländer, Franzosen. Im Zentrum der Stadt erhoben sich Paläste und Stadtvillen, deren Bewohner französische Kleidung trugen und es vorzogen, Französisch oder Deutsch zu sprechen. Seit seiner Entstehung war Petersburg Russland fremd. Im Namen der Stadt sowie von Ortschaften in der Gegend gibt es auch heute noch die für das russische Ohr fremden Suffixe «-burg» und «-hof».
Das imperiale Petersburg beendete seine Existenz im ersten Jahr des Ersten Weltkriegs. Wenige Jahre später fand jene Periode der russischen Geschichte ihren Abschluss, die gewöhnlich das «Petersburger Zeitalter» genannt wird: Anfang 1918 wurde die Hauptstadt nach Moskau verlegt.
Der Tourist, der nach Stadt Petersburg kommt, sucht den Ort ihres vergangenen Ruhms. Im Reiseführer liest er über den Winterpalast oder die Eremitage (die ehemalige Zarenresidenz), über die Paläste, die die Namen ihrer früheren Besitzer tragen - Bobrinski, Stroganow, Scheremetjew . . . Er möchte den Uferstrassen der Newa entlangspazieren und die berühmten Vorstädte sehen - Zarskoje Selo, Pawlowsk und Peterhof mit ihren Palästen und Parkanlagen. Die mächtige Zarenstadt, von Poeten besungen, von Mythen und Legenden umwoben - das ist das Bild von Petersburg, das im europäischen Bewusstsein verankert ist.
Doch es gibt noch eine andere Stadt - diejenige, in der ich mein ganzes Leben verbracht habe. Ich wurde während der Blockade geboren. Die Blockade von Leningrad kennt jeder, darüber sind viele Bücher geschrieben worden. Diese Bücher habe ich freilich nie gelesen. Ich kenne die Blockade aus den Erzählungen meiner Mutter, und das mehr als hinreichend. Der Winter 1941/42, den meine Mutter, die Petersburger Deutsche Lidija Brun, in Leningrad verbrachte, war die furchtbarste Prüfung ihres Lebens. Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten - alle starben in diesen schrecklichen Monaten. Meine Eltern konnten sich retten, sie wurden im letzten Moment nach Moskau evakuiert. In das einzige Bündel, das sie in den vor Hunger kraftlosen Armen kaum tragen konnten, war ihr sechsmonatiger Sohn gewickelt.
1945 kehrten wir zurück, in eine demolierte und ausgeraubte Wohnung. Ich kam in die Schule. Wie jedes sowjetische Kind wurde ich gleichzeitig in drei Kollektiven erzogen: in der Familie, in der Schule und auf dem Hof. Jedes dieser Kollektive lebte nach seinen eigenen - völlig unterschiedlichen! - Gesetzen. In der Familie (jedenfalls in meiner) herrschte eine Moral, die ihren Ursprung hatte in den hohen Prinzipien der russischen Intelligenzia, in der Schule herrschte die sowjetische Ideologie und auf dem Hof das Recht der Strasse.
Nach dem Unterricht spielten wir Fussball in den Alleen des Alexandergartens. Ganz in der Nähe brodelte der Newski Prospekt, das Gebäude der Admiralität ragte empor, ein wenig weiter entfernt stand der Winterpalast (die Eremitage), und der traurige Engel auf der Spitze der Alexandersäule blickte mit geneigtem Kopf auf uns herunter. Hinter dem Zaun des Alexandergartens lag der Schlossplatz, entlang dem Fluss zog sich das Palastufer. Heute ist dieser Platz mit Touristenbussen überfüllt, und hier drängen sich mehr Fremde, Ausländer zumeist, als Petersburger. In den 1950er Jahren hingegen gab es wenig Touristen, und an Ausländer konnte man sich damals in Petersburg kaum noch erinnern. Deutsche, Holländer, Franzosen: Das waren unbekannte Stämme, die auf einem fremden Planeten lebten, wohin niemand von uns je gelangen würde.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir uns damals an der grossartigen Newa-Landschaft oder am Panorama der Wassili-Insel erfreut hätten. Der graue nördliche Himmel, die granitenen Uferbefestigungen der Newa, die über dem Fluss hängenden Brücken, «die strenge Wohlgestalt», für die sich Alexander Puschkin begeisterte - all das strömte in unser kindliches Bewusstsein, ohne es allzu sehr zu berühren. Ebenso wenig wird jemand die Schönheiten Venedigs bemerken, der von Kind an in dieser Stadt gelebt hat.
Der Alexandergarten, in dem wir spielten, weil wir in der Nachbarschaft wohnten, war für uns keineswegs ein historischer Ort, sondern eher Spiel- oder Sportplatz. Die Gebäude der Umgebung hatten für uns keine Anziehungskraft, im Gegenteil, mit ihrer Undurchdringlichkeit stiessen sie uns ab. Als natürliche Wohnumgebung blieben die Höfe - und eben dort spielte sich auch das Leben der meisten sowjetischen Kinder und Jugendlichen ab, für die die Strasse weit wichtiger war als die Familie oder die Schule.
Die Petersburger Höfe gleichen, wenn man sie von oben betrachtet, gewaltigen Schächten oder Grabstätten - sie bilden eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, die in keinem Reiseführer erwähnt wird. Diese Höfe in ihrer heutigen Form entstanden im 19. Jahrhundert, als im Stadtzentrum zunehmend auch Wohnhäuser gebaut wurden. Prunk und Pracht lebten in Petersburg schon immer einträchtig Seite an Seite mit entsetzlicher Armut; schmerzlicher als andere hat diese Dualität wohl Dostojewski empfunden - der Sänger der Petersburger Elendsviertel und «dunklen Winkel». Übel riechend und staubig im Sommer, feucht und neblig im Herbst, eisig und düster im Winter, die Stadt der Schenken, Spelunken und Polizeireviere - das ist das Petersburg Dostojewskis, der das Bild einer gespenstischen, geheimnisvollen, phantasmagorischen Stadt erschuf. Puschkin besang das architektonische Ensemble des Schlossplatzes, Dostojewski die Wohnviertel um den Heumarkt. Dostojewskis zwiespältiges, kränkliches Petersburg ist dem harmonischen Petersburg Puschkins genau entgegengesetzt.
Diese Hinterhofschächte haben sich bis heute erhalten, und ihr Erscheinungsbild wurde während der Sowjetzeit noch unansehnlicher als zu Zeiten Dostojewskis. Nur wenige Europäer, die in gepflegten Städten aufgewachsen sind, werden beim zufälligen Blick in einen gewöhnlichen Petersburger Hinterhof nicht erschrecken. Abbröckelnde Torwege, aufgesprungener Asphalt mit klaffenden Rissen, winzige, halbblinde Fenster, die auf die Müllbehälter hinausgehen, und schliesslich der Müll selbst, Haufen von Abfall aller Art, der aus riesigen Containern herausquillt wie Teig aus dem Backtrog - eine Dekoration, wie sie Hollywood nicht im Traum einfiele!
In Petersburg lässt es sich gut Dichter oder Künstler sein und aus der Schönheit oder der Hässlichkeit der Stadt Inspiration schöpfen. Es lässt sich gut Tourist sein, hingerissener Wanderer, Betrachter der Petersburger Paläste und Uferstrassen. Ganz anders jedoch ergeht es den Bewohnern der Stadt, die auf ewig in Kommunalkas, die überfüllten Gemeinschaftswohnungen, gezwängt sind und sich auf den Raum der Hinterhöfe mit den Müllcontainern beschränken müssen.
In den letzten Februartagen dieses Jahres kamen Ljudmila Beloussowa und Oleg Protopopow, Olympiasieger und Stars des sowjetischen Eiskunstlaufs, nach Petersburg. Zwanzig Jahre nachdem die beiden um politisches Asyl in der Schweiz gebeten hatten, besuchten sie erstmals wieder ihre Heimatstadt. In einem Interview erklärte Ljudmila Beloussowa, das heutige Petersburg erinnere sie gleichzeitig an New York und Paris. - Gut möglich. Seit Leningrad Anfang der 1990er Jahre wieder zu Petersburg wurde, wurde es mehr und mehr von Werbung überwuchert, farbige Plakate und leuchtend bunte Aushängeschilder tauchten auf, davon viele nicht auf Russisch. Schillernde Reklametafeln am Tag, vielfarbige Lichter am Abend - nach und nach erhält Petersburg wahrhaftig das Aussehen einer europäischen Stadt, und als solche erschien es auch den beiden Sportlern.
Diejenigen, die zur Feier des 300-Jahre-Jubiläums von Petersburg kommen, werden die Stadt wahrscheinlich mit den gleichen Augen betrachten und entdecken. Sie werden bezaubert sein von den frisch gestrichenen Fassaden, dem restaurierten Engel auf der Alexandersäule, den gepflasterten Trottoirs und den leuchtenden Farben der neuen Strassencafés. Viele werden überzeugt sein, die Stadt Dostojewskis sei endgültig verschwunden, vom Antlitz der Erde getilgt. Keineswegs! Fragen Sie Ihre Petersburger Bekannten, und sie werden Ihnen erklären, dass die Stadt Dostojewskis bis heute lebendig ist und sich kaum verändert hat. Verlassen Sie den Schlossplatz und den Newski Prospekt, der wie eine vollkommen europäische Strasse wirkt, und treten Sie ein in das Freilichtmuseum der Hinterhofschächte - halb Höhlenzeitalter, halb absurdes Theater! In keiner anderen Grossstadt der Welt prallen Vergangenheit und Gegenwart, blendende, monumentale Fassade und abstossender Alltag hinter den Kulissen so unverhohlen und schroff aufeinander wie in Petersburg.
Drei Jahrhunderte und drei Namen, die auf Petersburg lasten, das gebrochene Schicksal der Stadt und ihr unorganischer, dualistischer Charakter haben Petersburg schon längst zum unheilschwangeren Trugbild werden lassen, zur Ausgeburt einer kranken Phantasie. «In Petersburg zu leben, heisst: in einem Sarg zu schlafen», schrieb Ossip Mandelstam. Das eigentümliche, fremdartige Wesen Petersburgs brachte nicht nur seine bizarren Bilder hervor, sondern auch die Prophezeiungen seines unvermeidlichen Untergangs. Die Feinde der Reformen Peters des Grossen schickten der Stadt, die seinen Namen trägt, seit alters Verwünschungen. «Von der Zarin Awdotja verflucht / Dostojewskis dämonische Stadt», schrieb Anna Achmatowa über Petersburg. Viele glaubten auch, Petersburg könne nur Hauptstadt sein, andernfalls drohe ihm der Untergang.
Im 20. Jahrhundert wurde die Stadt mehrmals verwüstet - es schien, als erfüllten sich die schrecklichen Verwünschungen. Anfang der 1920er Jahre - nach Revolution, Elend und rotem Terror -, hatte sie die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren. Die Menschen, die in den Palästen und den Stadtvillen gelebt hatten, waren erschossen oder verbannt, nur einigen wenigen gelang es, sich zu retten und ins Ausland zu fliehen. Nachdem sie ihren hauptstädtischen Glanz verloren hatte, verfiel die Stadt zusehends. Sie überlebte Elend, Hunger und Repression, die Säuberungen und die Blockade, sie änderte ihren Namen dreimal. Vom alten Petersburg ist im Grunde genommen schon Mitte der 1930er Jahre fast nichts mehr geblieben.
Die antisemitischen ideologischen Kampagnen Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre versetzten der noch verbliebenen Leningrader Intelligenzia einen Schlag, von dem sie sich nie wieder erholen konnte. Ich kann mich nicht daran erinnern, obgleich mein Vater, Professor der Leningrader Universität, ebenfalls ein Opfer dieser Kampagne wurde. Dafür erinnere ich mich noch gut an die Zeit Anfang der 1970er Jahre. Der Eiserne Vorhang hatte einen Riss bekommen, durch den alle diejenigen, denen die Atmosphäre der Stagnation unerträglich geworden war, in den Westen strebten. Viele von ihnen kannte ich persönlich. Im Westen wurden sie später zu Recht berühmt, und heute kennt sie die ganze Welt: Michail Baryschnikow, Joseph Brodsky, Efim Etkind. Das war der letzte einer Reihe von unwiederbringlichen Verlusten.
Prophezeiungen und Vorurteile bestimmen vieles in der Geschichte, ganz besonders in der russischen. Die Frage von Petersburg als Hauptstadt wird seit Anfang der 1990er Jahre in Russland wieder heftig diskutiert. «Zweite Hauptstadt», «Kulturhauptstadt», «Nördliche Hauptstadt» - das sind heute gewohnte Definitionen von Petersburg. Die neue gesellschaftlich-politische Situation in Russland, die im Jahre 2000 dadurch entstanden ist, dass eine «Petersburger Mannschaft» an die Macht kam, hat dieser Frage, die tief in der russischen Geschichte wurzelt, noch mehr Gewicht verliehen.
Der erste Schritt zur Rückkehr Petersburgs in die Kategorie der Hauptstädte wurde vor einigen Jahren gemacht, als am Ufer des Finnischen Meerbusens mit der Sanierung des Grossen Konstantin-Palastes aus dem 18. Jahrhundert begonnen wurde. Dieser Palast wird in Kürze zur Hauptresidenz des Präsidenten in der Nördlichen Hauptstadt. Im historischen Zentrum Petersburgs werden bereits Gebäude geräumt, bald sollen einzelne Föderationsbehörden aus Moskau hierher verlegt werden. Noch weiss man nicht, ob Petersburg sich den Status der Hauptstadt zurückerobert, aber Rolle und Bedeutung dieser Stadt werden mit der Zeit ganz gewiss wachsen. In Russland gibt es zwei Hauptstädte - das ist heute für jedermann ersichtlich.
Doch während am Stadtrand ein Zarenpalast wiedererrichtet wird, bleibt der zentrale Teil der Stadt mit den Hinterhöfen seinem Wesen nach unverändert: Tausende Petersburger hausen weiterhin in Kommunalkas, Tausende Obdachloser wühlen unverhohlen in Mülleimern und schlafen auf Treppenabsätzen. Es gibt zwar bereits einige Höfe, die mit Metalltoren abgesperrt wurden und verschlossen oder bewacht sind. Aber das sind wenige. Prunk und Pracht liegen wie früher neben Elend und Zerfall. Das Petersburg der imperialen Macht und das Petersburg der Elendsviertel, die Stadt Puschkins und die Stadt Dostojewskis, die Paläste und die Höfe liegen seit alters in einem erbitterten Streit miteinander, dessen Ende nicht abzusehen ist.
Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg
17. Mai 2003, 09:12, Neue Zürcher Zeitung
Von Ulrich M. Schmid
Es gibt im Westen ein klassisches Missverständnis, wenn die Rede auf die sowjetische Untergrundkultur kommt: Man nimmt selbstverständlich an, dass politischer Protest als entscheidender Grund für das Abtauchen einzelner Schriftsteller aus dem staatlichen Literaturbetrieb verantwortlich ist. Nun lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass die meisten Autoren des Untergrunds der offiziellen Sowjetideologie wenig Positives abgewinnen konnten. Trotzdem trifft die Vorstellung eines direkten Konflikts zwischen offizieller und nichtoffizieller Kultur in der Regel nicht zu. Die meisten Autoren im Untergrund ignorierten die staatliche Sphäre ganz einfach - in den sechziger Jahren war der sklerotische Zustand des sozialistischen Realismus bereits so offensichtlich, dass sich nicht einmal mehr ein satirischer Protest gegen das ästhetische Diktat der Machthaber lohnte. Auch der Kampf gegen das sowjetische Unrechtsregime trat gegenüber den rein künstlerischen Interessen der Untergrundautoren in den Hintergrund. Deshalb war es ein Missverständnis, als der Frankfurter Exilverlag «Possev» im Jahr 1956 die Schriftsteller in der Sowjetunion aufforderte, ihre «antikommunistischen Propagandamaterialien» nach Deutschland zu schicken und dort drucken zu lassen. Besonders befremdend musste in den Augen der Untergrundkünstler die Selbstcharakterisierung des Verlags als «Stimme der revolutionären russischen Bewegung» wirken - der Exilverlag verwendete hier paradoxerweise dieselbe ideologisch hypertrophierte Sprache wie das Sowjetregime, gegen das er ankämpfte.
Ein Zentrum der inoffiziellen Literatur bildete zu Beginn der sechziger Jahre das Haus von Anna Achmatowa (1889-1966) im Vorort Komarowo. Achmatowa selber galt als lebende Legende: Sie hatte alle massgeblichen Autoren des frühen 20. Jahrhunderts noch persönlich gekannt und mit ihren eigenen Gedichten einen eminenten Beitrag zum «silbernen Zeitalter» der russischen Lyrik geleistet. Achmatowas Werk konnte während der Stalinzeit kaum in der Sowjetunion gedruckt werden; auch später gelangten nur sorgfältig zensierte Texte in den offiziellen Literaturbetrieb. Gerade deshalb genoss aber Achmatowa während ihres letzten Lebensjahrzehnts in Literaturkreisen höchste Autorität, die zusätzlich durch internationale Auszeichnungen (Taormina 1964, Oxford 1965) gestützt wurde.
Eine Reihe von jungen Dichtern versammelte sich regelmässig bei Achmatowa: Jewgeni Rejn, Dmitri Bobyschew, Anatoli Najman und Joseph Brodsky. Während eines Winters mietete Brodsky sogar eine Datscha in der Nähe von Achmatowas Haus, um die Dichterin öfter sehen zu können. Dabei ging es nicht einmal so sehr um eine literarische Affinität - Brodsky war vor allem von der persönlichen Statur Achmatowas beeindruckt. Nach dem Tod der «grande dame» prägte Bobyschew für die Gruppe der vier Dichter die Bezeichnung «Achmatowa-Waisen» - in der Tat führten sie in einem gewissen Sinn das geistige Erbe der grossen Lyrikerin weiter: Vor allem Brodsky hat stets darauf hingewiesen, dass sich die Poesie nicht an die politische Tagesaktualität verkaufen dürfe, sondern das wichtigste Erfahrungsmedium des Menschen, die Sprache, in unbedingter Authentizität am Leben erhalten müsse.
Die apolitische Ausrichtung des Leningrader Untergrunds zeigte sich deutlich in zwei Prozessen, die in den sechziger Jahren die Öffentlichkeit bewegten - in beide Affären war auch der junge Joseph Brodsky verwickelt. 1961 wurden die Buddhisten Alexander Umanski und Oleg Schachmatow wegen versuchter illegaler Grenzüberschreitung angeklagt - ursprünglich wollten sie sich durch reine Gedankenkraft aus Armenien in die Türkei versetzen. Als auch den überzeugten Esoterikern klar wurde, dass dieses Vorhaben unpraktikabel sei, verlegten sie sich auf den Plan, ein Flugzeug zu entführen und nach Tibet zu den Gurus zu fliegen. Ursprünglich hätte Brodsky mit von der Partie sein sollen; er gab den Entführungsplan vorzeitig auf, wurde aber während des Prozesses als Zeuge vernommen. Die Affäre Umanski/Schachmatow zeigt deutlich, dass religiöse Exaltation in der Leningrader Bohème eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielte wie die politische Nichtanpassung. Eine traurige Bestätigung erfuhr diese Tatsache im Jahr 1965, als ein anderer Freund Brodskys, Wladimir Schweigolz, seine Freundin in einem existenzialistischen Experiment umbrachte. Das Opfer hatte in ritueller Trance in den eigenen Tod eingewilligt.
Joseph Brodsky verfasste 1969 ein Protestgedicht gegen Schweigolz' künstlerisches Verbrechen: «Hier lebte Schweigolz, der seine Geliebte nur um des Spektakels willen erstach. Er sprach: _Jetzt ist sie im Paradies._ Damals kursierten Gerüchte, dass er sich selbst am Rand des Wahnsinns befand. Lüge! Ich protestiere. Er war ein Poseur.» Anatoli Najman erinnert sich, wie er Schweigolz nach der Verbüssung einer achtjährigen Lagerstrafe wieder traf: «Ich sah, dass er im Rollstuhl sass und nur noch über Beinstümpfe verfügte. Er erklärte, dass ihm im Lager die Beine abgefroren seien und dass man sie ihm mit den Jahren nach und nach amputiert habe.» Schweigolz' selbst inszeniertes Schicksal markiert das Auseinandertreten von Ästhetik und Ethik: Die Suche nach immer ausgefalleneren Kunstformen gipfelt schliesslich in der Gewalt am fremden und eigenen Körper und überschreitet damit die Grenze zwischen Kunst und Pathologie.
Nach der Machtergreifung Breschnews verschärfte sich das kulturpolitische Klima in Sowjetrussland zusehends. 1964 wurde Joseph Brodsky wegen Nichtausübung eines sozial anerkannten Berufs (im Sowjetjargon: wegen «Parasitentums») von einem Leningrader Gericht zu einer Lagerstrafe von fünf Jahren verurteilt. Dieser Prozess machte in aller Schärfe deutlich, dass ausserhalb der gesellschaftlichen Strukturen des Arbeiter- und Bauernstaates keine individuellen Existenzmöglichkeiten vorgesehen waren. Wer seinen Lebenssinn nicht im kommunistischen Aufbau erblickte, musste einen Scheinberuf ausüben, wenn er nicht mit den staatlichen Repressionsorganen in Konflikt geraten wollte. Bisweilen kam es bei diesen Camouflagen zu bizarren Allianzen: Der spätere Kultautor Sergei Dowlatow (1941-1990) arbeitete in seiner Jugend als persönlicher Sekretär der parteitreuen Sowjetautorin Vera Panowa, die ihn dadurch vor politischer Verfolgung bewahrte. Solche Zufluchtsorte waren jedoch nur als Glücksfälle möglich. Viel häufiger verdingten sich Untergrundautoren als Pförtner oder Kesselwarte in einer der zahlreichen Heizzentralen der Stadt. Diese Stellen waren zwar miserabel bezahlt, galten aber als «sozial nützliche Arbeit». Ausserdem konnten die nicht allzu anspruchsvollen Dienstpflichten auch in nicht mehr ganz nüchternem Zustand ausgeübt werden, liessen genügend Zeit für die literarische Arbeit und - in Leningrad kein unwesentlicher Punkt - boten einen warmen Aufenthaltsort.
Die Ausgrenzung eines privaten Reservats aus dem öffentlichen Herrschaftsraum erforderte Mut und Zivilcourage. Das gilt auch für die inoffiziellen literarischen Foren. Die erste Leningrader Untergrundzeitschrift wurde in den Jahren 1975 bis 1981 von Viktor Kriwulin (1944-2001) und Tatjana Goritschewa (geb. 1947) herausgegeben und trug den rätselhaften Titel «37». Man vermutete eine Anspielung auf das Kulminationsjahr des Grossen Terrors; die Zahl bezeichnete aber nur die Nummer von Kriwulins Wohnung. Das Missverständnis ist bezeichnend: Die Nennung einer Privatadresse wirkte ebenso subversiv wie die Erinnerung an die dunkle Geschichte der Sowjetmacht. Im Leningrader Untergrund schwang im Begriff des Privaten immer auch ein ästhetisches Pathos mit: Noch in seiner Nobelpreisrede aus dem Jahr 1987 begreift Joseph Brodsky die Kunst wesenhaft als Ausdruck der Privatheit der menschlichen Existenz.
Gerade an Brodskys Beispiel lässt sich aber auch die durchaus ambivalente Haltung des Leningrader Untergrunds zu den öffentlichen Literaturinstitutionen beobachten. Nach der Rückkehr aus der Verbannung bemühte sich Brodsky um eine Publikation seiner Gedichte im Verlag «Der Sowjetschriftsteller». Ein solches Vorgehen hat jedoch nichts mit Anbiederung bei den Machthabern zu tun. Es war den Autoren klar, dass sie mit den handgetippten Samisdat- Ausgaben ihrer Werke nur einen sehr kleinen Leserkreis erreichen konnten. Man versuchte deshalb nicht selten, sowohl im offiziellen wie auch im nichtoffiziellen Literaturbereich Fuss zu fassen. Andrei Bitow (geb. 1937) gelang es, diese nicht immer ungefährliche Gratwanderung erfolgreich zu absolvieren. In den sechziger Jahren war Bitow Mitglied des sowjetischen Schriftstellerverbands und publizierte in verschiedenen Staatsverlagen vier Erzählbände. Gleichzeitig schrieb er an seinem Roman «Das Puschkinhaus», der mit allen Traditionen des sozialistischen Realismus brach. Der Roman wurde wegen seiner postmodernen Komposition von mehreren Verlagen abgelehnt; gleichwohl konnten einzelne Kapitel in offiziellen Literaturzeitschriften erscheinen.
Anfang der siebziger Jahre kursierte der Text im Samisdat und sicherte seinem Autor höchstes Prestige in den inoffiziellen Literaturkreisen. 1978 erschien im amerikanischen Exilverlag «Ardis» die russische Erstausgabe des Romans - im Vorwort, das Bitow selbst dem Herausgeber in die Feder diktiert hatte, wird darauf hingewiesen, dass der Roman ohne Wissen des Autors erscheine. Auf beiden Seiten kamen mithin gezielte Deeskalationstechniken zum Einsatz: Die sowjetischen Instanzen vermieden es durch die Teilpublikation, den Roman mit einer Aura des absoluten Verbots zu umgeben; Bitow selber baute den Strafverfolgungsbehörden eine goldene Brücke, die ein Stillhalten ermöglichte - noch wenige Jahre zuvor hatten verbotene Auslandspublikationen bei Pasternak, Sinjawski und Solschenizyn zum Eklat geführt.
Im sowjetischen Literaturbetrieb waren nicht nur die stilistischen Geschmackspräferenzen, sondern auch die Umgangsregeln der Akteure genau kodifiziert. Es gab eine klare Hierarchie unter den Schriftstellern, die sich in der unterschiedlichen Zuteilung von Privilegien (Reisen, Datscha, Auto usw.) äusserte. Der Leningrader Untergrund stellte diesem steifen System eine eigene Verhaltensgrammatik gegenüber, die auf einem romantischen Freundschaftskult basierte. Die offiziösen Rangordnungen wurden durch persönliche Affekte konterkariert. So heisst es etwa im Manifest zur Untergrundzeitschrift «Gepäckaufbewahrung» 1984 programmatisch: «Wir stellen weder eine _Richtung_ noch eine _Bewegung_ oder eine _Organisation_ dar. Wir sind ein Kreis von Freunden, die einige grundsätzliche Vorstellungen darüber teilen, was gute Literatur ist.»
Während bei zahlreichen inoffiziellen literarischen Vereinigungen private Nähe eine wichtige Voraussetzung für das Schreiben darstellte, wurde bei der Leningrader Gruppierung «Mitki» die Freundschaft selbst zum wichtigsten Inhalt der Kunst. Das äussert sich bereits in der Benennung der Gruppe: Ein «Mitjok» (Pl. «Mitki») ist ein Freund von Dmitri («Mitja») Schagin, einer Kultfigur in der Leningrader Kunstszene der achtziger Jahre. Eine wichtige Rolle bei der Pflege der Freundschaft der «Mitki» bildet der gemeinsame Alkoholkonsum, der alle Beteiligten in eine sanftmütige Stimmung bringt. Die «Mitki» legen keinen Wert auf ihre äussere Erscheinung, sie bevorzugen blau-weiss gestreifte T-Shirts. Ihre Sprache zeigt eine Vorliebe für zärtliche Diminutive; auf ihrer Website (www.kulichki.com/mitki) ist die Rede sogar von «Linklein». Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben allerdings auch die «Mitki» ihre ideologische Existenzgrundlage verloren: 1993 organisierte das Staatliche Russische Museum eine «Mitki»-Ausstellung und erhob die Künstlergruppe damit genau in jenen Status der arrivierten Offizialität, dem die «Mitki» früher konsequent ausgewichen waren.
Dostojewski hat mit seinen «Aufzeichnungen aus dem Untergrund» einen Schlüsseltext für die russische Alternativkultur verfasst. In diesem chaotischen Monolog fordert ein deklassierter Intellektueller trotzig das letzte Recht ein, das ihm verblieben ist: sein eigenes Unglück zu wollen. Das darf allerdings nicht als Ausdruck jener verzehrenden Selbstquälerei missverstanden werden, die man Dostojewskis Figuren so oft zuschreibt. Der Untergrundmensch sucht nämlich das Leiden nicht um des Leidens willen, sondern weil er sich nur im Unglück über das flache Alltagsbewusstsein erheben kann. Die lebensweltliche Askese des Untergrundmenschen ist mit einer höheren Erkenntnis verbunden - in diesem Sinne ist sie durchaus einer religiösen Praktik vergleichbar.
Eine solche Haltung war auch im Leningrader Untergrund der späten Sowjetzeit weit verbreitet: Man verabschiedete sich bewusst aus der illusionären Zeichenwelt des strahlenden Kommunismus, in dem Anspruch und Realität schon längst nicht mehr zur Deckung gebracht werden konnten. Für das kostbare Recht, authentische Sprachkunstwerke hervorzubringen, nahm man die gesellschaftliche Randstellung in Kauf. Mehr noch: Die marginale Position im offiziellen Kulturbetrieb wurde gewissermassen zur ersten Voraussetzung des künstlerischen Schaffens. Nur im Untergrund konnte man aus den staatlich verordneten kognitiven Mustern ausbrechen und ein autonomes Selbstbewusstsein entwickeln. Solch höhere Erkenntnis schloss aber immer die Einsicht in die eigene prekäre Lebenslage ein. Deshalb galt auch für viele Leningrader Künstler der ambivalente Neid auf das biedere Lebensglück des Establishments, den bereits Dostojewskis Untergrundmensch formuliert hatte: «Es lebe der Untergrund! Ich habe zwar gesagt, dass ich den normalen Menschen bis auf die Galle beneide, aber in den Bedingungen, in denen ich ihn sehe, möchte ich nicht mit ihm tauschen (obwohl ich nicht aufhöre ihn zu beneiden. Nein, nein, der Untergrund ist in jedem Fall besser).»
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Von Thomas Grob
Es begann spätestens mit der Gründung. Bildeten sich bei anderen Städten Legenden um ihre Grundsteinlegung, wurde im Falle von «Sanktpiterburch» die historische Gründung zur Legende: Unaufhaltsam schreitet der Reformer Peter I., später der Grosse genannt, mit seiner ganzen hünenhaften Gestalt durch die Sumpflandschaft des eben den Schweden abgenommenen Newa- Deltas - der Krieg war noch in vollem Gange - und beschliesst, hier eine Festung zu bauen. Bald schon sollte es gar eine prachtvolle Hauptstadt werden: ein «Paradies». An diesem Ort der geplanten Wunder sollte nichts dem Zufall des Wucherns und Werdens überlassen werden. Die Stadt war gebaute Idee und Demonstration der Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der eigenen Kultur wie gegenüber der Natur. In der Absicht, das Beste von allem zu versammeln, was es in der modernen Welt, die Peter bereist hatte, so gab, entstand die «barockeste» aller europäischen Städte: eine durchgestaltete Hauptstadt am Rande nicht nur des Landes, sondern überhaupt der Zivilisation. Gebaut wurde sie von Zwangsarbeitern, die von den westlichen Errungenschaften, denen sie den Weg ebnen sollten, noch nie etwas gehört hatten. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war es verboten, die Tausende von Toten bei diesem aberwitzigen Bauprojekt auch nur zu erwähnen.
Bereits die Gründung war somit pragmatischer und symbolischer Akt zugleich: ein militärisches und geopolitisches Signal - Russland wird Seemacht - wie Ausdruck eines ungehinderten Schöpferwillens und geistreiches concetto voll scheinbarer Paradoxie. Doch will eine solcherart erfundene Welt- und Hauptstadt ausgedeutet werden: Und so entstand im 18. Jahrhundert eine ganze Tradition von Texten (Predigten, Lobreden, Oden), die dem Werk und seinem Schöpfer gebührend Sinn verliehen. Dazu bediente man sich traditioneller dichterischer Formen des Städtelobs, der Motive anderer Stadtgründungen - so soll, wie bei Byzanz, ein Adler Peter den Ort gewiesen haben -, oder man mythologisierte Peter zum zweiten Petrus und zum Demiurgen, der in einem Akt der momentanen Schaffung aus dem Nichts, aus dem Urchaos der Sümpfe diesen idealen Mikrokosmos erschuf.
Dabei ging es nicht ausschliesslich darum, Peter und seine Stadt, der eine historisch gewachsene Legitimation fehlte, zu sakralisieren. Petersburg sollte mehr sein: Symbol eines neuen Russland, Modell einer neuen Gesellschaft. Der Sumpf - das war das alte Russland, das nun dem modernen, unbezwingbaren Gestaltungswillen Platz machte, für den der Stein stand, der - nomen est omen - als Baumaterial vorgeschrieben war. Petersburg als «Fenster zum Westen» - das Diktum, mit dem die Stadt heute wieder Werbung macht, konnte damals nur von einem westlichen Ausländer mit dem für diese typischen kulturellen Narzissmus stammen: Der Italiener Francesco Algarotti prägte es 1739 in seinen «Briefen aus Petersburg». Was Peter wollte, war kein «Fenster», sondern ein Zentrum: ein exzentrisches zwar, das unbeeinflusst war von aller Tradition, eines, das in sich eine Sammlung westlicher Zitate darstellte - aber auch eines, das in seiner Künstlichkeit eine eigene Ordnung repräsentierte, die sich über die strahlenförmig angelegten Magistralen hinaus auf das ganze Land ausbreiten sollte.
So ist Peter nicht nur verantwortlich für die Existenz und die Anlage dieser Stadt (die spätere Erweiterungen immer beibehielten), sondern auch dafür, dass sie als Symbol zu gelten hatte für ein Kulturprojekt, das nicht weniger als die Zukunft Russlands meinte und insbesondere dessen Beziehung zum Westen. Peter erwies sich öfter als geschickter Semiotiker, der um die Macht der Zeichen wusste. So konnte er seiner Stadt (die offiziell nicht nach ihm, sondern nach seinem Namenspatron benannt war) unlöschbar einen Diskurs über das Schicksal des Landes einschreiben. Wie dieser aber konkretisiert und verstanden wurde - das stand schon bald auf einem ganz anderen Blatt und entzog sich, wie im Reich der Zeichen nicht unüblich, der Allmacht des Autors.
Bereits mit der Gründung entstanden Deutungen Petersburgs, die sich gegen Peter richteten; sie kehrten seine «mythologischen» Grundlagen einfach um. So stand in ihrem Fokus ein nicht weniger sakralisierter und bedeutungsschwangerer Ort, der nun aber zu einem des Verderbens, des Teufels wurde. Das apokalyptische Petersburg schien sich zuerst im einfachen Volk zu verbreiten. Darauf nimmt der berühmte Ausspruch Bezug: «Petersburg soll vom Erdboden verschwinden, viele sprechen davon», der Peters erster Frau Awdotja zugeschrieben wird, die ins Kloster gesteckt worden war. Dies wurde für die nächsten zwei Jahrhunderte zur Parole derjenigen, die die Ausrichtung Russlands am Westen kritisierten, und die Vorstellung vom baldigen Untergang der Stadt wurde zum festen Bestandteil ihres Mythos. Das diabolische, apokalyptische Petersburg-Bild, das besonders stark in Kreisen der Altgläubigen verankert war, konnte sich auf die petrinischen Bildlichkeiten berufen: nur dass der Sumpf und das Meer nun nicht mehr für die Rückständigkeit des Alten und die Weltoffenheit des Neuen standen, sondern beides zusammen für die Elemente, die diese Stadt wieder verschlingen würden. Tatsächlich wurde Petersburg regelmässig von teilweise katastrophalen Hochwassern heimgesucht - die göttliche Strafe für ein Bauwerk, das Menschen in unmenschlichem Gelände ansiedelte, für das Verbrechen, Russland seines Zentrums beraubt und seine Kultur der Zerstörung anheim gegeben zu haben.
Somit stand die Existenz der exzentrischen Metropole immer doppelt in Frage: als dem Untergang geweihtes Zeichen der Hybris, aber auch als teuflische Chimäre, als vorgespiegeltes Prachtwerk des Antichrist, das - wie dies in Teufelserzählungen der Zeit vorkam - jederzeit wieder verschwinden konnte. Doch die Stadt stand, sie trotzte den Wassern wie den Propheten des Untergangs. Die mörderische Überschwemmung von 1824 wurde ein Jahrzehnt später zum Anlass eines literarischen Werks, dessen Wirkung auf die Deutungen der Stadt gewaltig war. Alexander Puschkins Verserzählung «Der eherne Reiter» enthält die Zeilen, denen heute noch kaum ein Besucher oder Sprachstudent entgeht: «Ich liebe dich, du Schöpfung Peters . . .»
Der poetische Geniestreich zitiert die panegyrischen Oden des vergangenen Jahrhunderts und macht Petersburg zum eigentlichen Thema: situiert im Kampf zwischen Stein und Wasser, zwischen künstlicher Ordnung und unbeherrschbarem Chaos. Dann jedoch wird die Geschichte des «kleinen Mannes» Evgeni erzählt, der in den Fluten seine Geliebte verliert, den Stadtgründer Peter in Form des «Ehernen Reiters», des berühmten Peterdenkmals von Falconet, verflucht und dann von diesem durch die gespenstische nächtliche Stadt verfolgt wird. Puschkin verbindet dies raffiniert mit Überlegungen zur Rolle Peters in der russischen Geschichte; die Formulierung Evgenis (die aber eigentlich von einem Freund Puschkins stammt), Peter habe das im Pferd symbolisierte Russland wohl eher zum Aufbäumen gebracht als in einen Vorwärtsgalopp, zeigt die ganze Ambivalenz der Gründerfigur. Angespielt wird auch auf die historischen Aufstände gegen die Zarenmacht - besonders auf die Dekabristen, die 1825 auf dem Platz des Denkmals scheiterten. Die Schönheit der Stadt, die letztlich triumphierende Stabilität ihrer künstlichen, auf Willen beruhenden Ordnung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Ordnung sich durchsetzen muss, was unschuldige Opfer fordert: Evgeni verliert den Verstand, und Peter selbst wird zum Sinnbild einer unbezähmbaren Elementarkraft, ein Gegenspieler, aber auch Ebenbild der tosenden Wassermassen.
Die Stadt als Stein gewordenes Symbol des Schicksals Russlands, die Stadt zwischen Schönheit und Chaos, als Traum und Albtraum zugleich - so offen wie Puschkin wird das kaum jemand wieder thematisieren. Zwar gibt es, etwa in Volksliedern, auch das Bild der fröhlichen Hauptstadt. Das Vokabular für den eigentlichen «Petersburger Text» jedoch, der nun auf der Basis des «Ehernen Reiters» entsteht - der Begriff stammt vom Kulturhistoriker Vladimir Toporov und meint das Geflecht von Bildern und Reflexionen über Petersburg, das eine hohe innere Konsistenz aufweist -, schöpft sich aus weniger ausgewogenen Quellen. Insbesondere Dostojewski ist es, der die Bilder der düsteren, schemenhaften Grossstadt und seiner kränklichen Bewohner prägt, denen es wie ihrer Stadt an jeder natürlichen Sicherheit und Verwurzelung fehlt. Er greift zurück auf die alten Vorstellungen des «verschwindenden» Petersburg - so sieht Arkadi («Der Jüngling») in einer Art Vision die faule, feucht-glitschige Stadt sich im Nebel auflösen - und lässt das phantasmagorische mit dem realen Petersburg verschmelzen. Raskolnikow («Verbrechen und Strafe») kann im prachtvollen Stadtpanorama nur «Kälte» erkennen, und Goljadkin («Der Doppelgänger») ist, wenn er sich wünscht, vernichtet zu werden, schon fast Produkt der stürmischen Petersburger Novembernacht, die er erlebt. Schon beim jungen Dostojewski haben die «Weissen Nächte» nichts gemein mit den hellen Sommernächten des Nordens. Stattdessen produzieren sie den Typus des schlaflosen, hintersinnigen Träumers, der von der Krankheit dieser Stadt gezeichnet ist. So wird die Stadt selbst zur alles überschattenden literarischen Figur.
Dostojewskis düstere Grossstadtbilder zwischen scheinhaftem Prunk und innerer Morbidität, in denen es keinen Platz gibt für den «wahren» Menschen, bringen auf den Punkt, wie sich Petersburgs semantische Koordinaten zu verschieben begonnen hatten. Interessanterweise waren es Moskauer, die den Petersburg-Mythos in ihrem Sinn umschrieben. Besonders die nachromantische Bewegung der Slawophilen, die in der einseitigen Ausrichtung Russlands auf den Westen einen schwerwiegenden Fehler sah, verstärkte seit den dreissiger Jahren die negativen Petersburg-Bilder: Petersburg als Ort des Nicht- Authentischen, als Stadt, in der Aristokraten und Beamte ein maskenhaftes, fremdbestimmtes Dasein führen. Die Kritik mischt sich hier mit derjenigen am aufkommenden Geldwesen, das für diese Kreise Kunst und Literatur, ja die Kultur insgesamt zu usurpieren und zu pervertieren schien. Die Stadt Petersburg, die immer im Gegensatz zu Moskau gezeichnet wurde (der Stadt des Weiblichen, Urwüchsigen, Religiösen, Traditionsverpflichteten), war Symbol dieser Modernisierungen, die aus dem Westen kamen.
Die Gestalt des Stadt gewordenen «Bösen» konnte verschieden motiviert sein. Der polnische Emigrant Adam Mickiewicz, der länger in Russland gelebt hatte und mit diesen Moskauer Kreisen gut befreundet war, zeichnet im dritten Teil seiner «Ahnenfeier» das Bild des erstarrten, schneebedeckten Petersburg, dessen Fassaden nicht über sein wahres Wesen hinwegtäuschen können, das sich für ihn in den Militärparaden zeigt: Petersburg als lebloses Zentrum des russischen Despotismus. Und auch der Ukrainer Gogol diabolisiert die Stadt in seinen «Petersburger Erzählungen»: Sie wird zum Ort des falschen Scheins (und damit des Teufels), der wahnsinnigen kleinen Antihelden, des Grotesken und Absurden. Nur in Petersburg kann einem die eigene Nase weglaufen, um alleine Karriere zu machen.
Doch Petersburg selbst, und vor diesem Hintergrund ist das Stadtbild Dostojewskis zu lesen, begann sich rasch zu wandeln. Nicht nur wurde die Stadt im Laufe des 19. Jahrhunderts vom administrativ-militärischen zunehmend zum industriellen und finanziellen Zentrum. Die Bevölkerung wuchs explosionsartig: War die Einwohnerzahl bereits zwischen 1750 und 1837 von 80 000 auf 470 000 gestiegen, so stieg sie insbesondere nach der Bauernbefreiung von 1861 immer rascher; vor dem Ersten Weltkrieg zählte die Stadt 2,2 Millionen Einwohner. Aus der Stadt der Paläste, Kanäle und Flanierboulevards wurde eine der Bahnhöfe und Fabriken, der Mietskasernen und Kaufhäuser. Die Stadt bestand nun zunehmend aus tatsächlich entwurzelten Menschen - die Zugereisten, meist Bauern, machten um 1900 etwa 70 Prozent aus -; sie hatte eine der höchsten Sterbe- und eine der niedrigsten Heiratsquoten des ganzen Landes (dafür blühte die Prostitution wie nirgendwo sonst). Um diese Zeit war auch die Wohndichte die höchste Europas: In einzelnen Vierteln lebten in einem einzigen Zimmer durchschnittlich mehr als acht Personen.
Um die Jahrhundertwende erlebte die Mythisierung der Stadt durch die Symbolisten einen letzten grossen Schub. Der Meilenstein ist sicher Andrei Belyis Roman «Petersburg», der als Teil einer Trilogie das Aufeinandertreffen von Westlichem und Östlichem, von Rationalität und Mystik thematisieren sollte. Die innere Widersprüchlichkeit der Stadt, auf feuchten Granit gebaut und in giftig-grüne Nebel gehüllt, das Rationalistisch- Geradlinige ihrer Anlage und ihr chaotisch-sumpfiges Wesen werden hier zur Kollision gebracht. Dabei erhält der Roman selbst eine eigene Räumlichkeit: er wird zum Ort, wo die russische Petersburg-Literatur nicht ohne Ironie vorbeiflaniert. Die Symbolisten (etwa der andere grosse Petersburg-Dichter, Alexander Blok) formulieren in ihren Briefen, was seit der Romantik Tradition hat: die Überzeugung, dass man im Grunde nur in Moskau leben kann, die sich jedoch mit der Unmöglichkeit verbindet, Petersburg für längere Zeit zu verlassen. Der Petersburger Text ist im materialisierten Wortsinn ein Gewebe, das seine Opfer nicht so leicht loslässt.
Dass die Symbolisten noch einmal die Nekropolis Petersburg thematisieren, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit dem späteren 19. Jahrhundert auch die Nostalgie Einzug hält. Sogar Anna Achmatova zitiert nicht nur Dostojewskis Petersburg, sondern ebenso die Puschkin'sche Liebe zur Stadt - auch wenn es eine «bittere Liebe» ist. Alexander Benois betont zwar das düstere Image der Stadt, zeichnet dazu aber die hinreissend poetischen Miniaturen, die ihren Reiz bis heute nicht verloren haben. Zusammen mit den zunehmenden Klagen über das Verschwinden der alten Stadt unter modernen Neubauten mehren sich auch die Bücher über das «alte» Petersburg, die Aufarbeitung seiner Topographien, seiner Lebenswelten und seiner anekdotischen Alltagsgeschichte. Einer, der sich beruflich mit solchen Stadtbildern befasste, wird der Stadt und seinem «Genius loci» in diesem Genre ein Denkmal setzen: Nikolai Anziferow. Nicht zufällig erscheint das Buch in dem Moment, als Petersburg nicht mehr Petersburg ist. «Wenn aber Petersburg nicht Hauptstadt ist», so Belyi in seinem Roman, «dann gibt es Petersburg nicht.»
Nach der Revolution, den Hungerjahren des Bürgerkrieges und der Verlegung der Hauptstadt nach Moskau hatte der Petersburg-Mythos in der alten Form seine Grundlage verloren. Leningrad, offiziell Stadt der Revolution, stand in Moskau immer im Verdacht der heimlichen Opposition; sie wurde deswegen meist repressiver regiert als die neu-alte Hauptstadt selbst. Ihr Name war eliminiert, als sollte die Petersburger Periode der russischen Geschichte ausgelöscht werden. Das Gegenteil trat ein, wie nach 1991 manifest werden sollte: Leningrad verstand sich, zumindest in intellektuellen Kreisen, gerade als Bewahrer der vorrevolutionären kulturellen Traditionen, an die man nach dem Ende der Sowjetunion anzuknüpfen versuchte. Doch die ersten postkommunistischen Hoffnungen verflogen rasch; die demokratische Stadtregierung dachte in alter Tradition lieber an die vergangene Glorie als an die neuen Bedürfnisse. Während für unrealisierbare Dinge viel Geld ausgegeben wurde, blieb etwa die Förderung des zusammenbrechenden öffentlichen Verkehrs aus, auf den der überwiegende Teil der Bevölkerung angewiesen war. - So präsent der Petersburger Mythos heute noch sein mag: Zur «Rettung» der Stadt und Russlands hat er, auch wenn Vladimir Toporov dies meint, kaum viel beizutragen. Zu wünschen wäre der Stadt nicht, dass sich Präsident Putin, der die aristokratisch- imperiale Symbolik schätzt, ihrer Geschichte bedient oder dass sie gar zur Hauptstadt wird. Zu wünschen wäre ihr eine Form des Pragmatismus, der vergessen liesse, dass man schon wieder beinahe zur Provinz geworden ist; nur sollte er nicht im Geiste der bisnesmeny erfolgen, sondern im Bewusstsein der historischen und imaginären Substanz dieser Stadt. Petersburg könnte dann nicht nur endlich ohne Hemmungen als eine der schönsten Städte Europas gesehen werden. Vielleicht würde sich sogar der ihm eingeschriebene petrinische Traum einer weltverbundenen Stadt, eines eigenen Mikrokosmos mit Wirkung nach aussen erfüllen, dies nicht in einem imperialen Sinn, sondern im Sinne ihrer Bürger und zum Wohl ihres Landes. Dann hätte man auch die Distanz, um den mythoiden Text, in den jeder Stein dieser Stadt eingewoben ist, neu zu lesen. Denn ohne ihn würde es Petersburg nicht geben.
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Von Adolf Max Vogt
Noch mitten im Grossen Nordischen Krieg, nach der Eroberung der schwedischen Festungen an der Newa im Jahre 1703, legte Zar Peter der Grosse den Grundstein zur künftigen Hauptstadt Russlands, Sankt Petersburg. Die Ambition des Zaren war riskant genug. Denn die Newa splittert sich in ihrem Sumpfdelta in drei Arme und nicht weniger als 42 Inseln auf. Das künftige Stadtgebiet würde deshalb von Überschwemmung bedroht bleiben, bloss 1 bis 3 Meter über Meer liegen und umfangreicher Schutzbauten bedürfen. Doch im Kalkül des Machthabers ging es um grössere Horizonte. Nämlich darum, dass Russland sich nun endgültig als Grossmacht im Ostseeraum behaupten konnte - anstelle des eben besiegten Schweden. Eine Stadtgründung rund um die zuerst auszubauende Festung Peter und Paul war da die logische Forderung. Und der Zar ist radikal unzimperlich, neigt zu scharfer Autorität und nimmt Brutalitäten in Kauf. Um die Hauptstadt auf dem Sumpfdelta als «Capitale ex nihilo« durchzusetzen, befiehlt er dem Adel, Moskau im Jahre 1712 zu verlassen und an der Newa Haus oder Palast selber zu errichten; 1718 erreicht dieselbe Order das diplomatische Korps; 1723 folgen die Richter mit ihren Stäben.
Das Elend der Gründerjahre nach 1703 beschreibt André Corboz in seinem Essay «Deux Capitales françaises Saint-Pétersbourg et Washington» (Infolio Editions, Gollion près Lausanne 2003) wie folgt: «Das sehr harte Klima, mit seinen langen Wintern und seinen brennend heissen, aber kurzen Sommern, hat die Aufgabe der Arbeiter in keiner Weise erleichtert - die übrigens nur über Schaufel und Hacke verfügten: keinerlei Schubkarren! Es sind also gerade die einfachen Berufe, die der Zar den härtesten Belastungen aussetzt. Um den Sumpfboden zu entwässern, mit Pfählen zu stabilisieren und die Festung zu errichten, befiehlt er die russischen, tatarischen, kalmückischen und finnischen Bauern zu Zwangsarbeit. (. . .) So wird man sich nicht wundern, dass allein schon auf dem Werkplatz für die Festung Tausende von Zwangsarbeitern verendet sind.»
Neben dem strategischen Ziel, die neue Grossmachtrolle an der Ostsee zu sichern, ist in den Entscheidungen des Zaren immer auch der Anspruch spürbar, die europäische Vorstellung von Stadt einzuholen. Der Kosmopolit Francesco Algarotti hat diese Ambition 1739 mit dem graziösen Bild «ein Fenster auf Europa» umschrieben. In der Tat hatte der junge Zar mit 25 Jahren England und die Niederlande besucht. Er schloss sich dabei inkognito einer Gesandtschaft an, welche den Stand der Schiffbaukunst zu erkunden und an mehreren Höfen Beistand im Kampf gegen die Türken zu suchen hatte.
Es scheint, so lautet eine These, dass sich dem jungen Herrscher auf dieser Reise vor allem die Stadt Amsterdam mit ihren Kanälen als ein Vorbild eingeprägt hat. Schon bei der Grundsteinlegung war klar, dass vor allem - und für Russland zum ersten Mal - die Schwelle von Holz zu Stein zu überschreiten war. (Auch Moskau war damals noch eine hölzerne Stadt, lediglich die Festung und Sakralbauten machten die Ausnahme.) Eine halb magische Schwelle - die auch zu kräftigen Missverständnissen Anlass geben kann. Etwa dem oft zu hörenden Vorwurf, mit dieser späten «Versteinerung» hinke Russland mehr als 2000 Jahre hinter Europa her. Holz blieb indessen auch in anderen nordischen Städten wie Helsinki oder Stockholm das bevorzugte Baumaterial, weil es extremer Kälte gewachsen ist und überdies ökonomische und konstruktive Vorteile bietet. Auf diesen letzten Aspekt nimmt El Lissitzky in seinem Buch «Russland - Architektur für eine Weltrevolution» (1929) mit einem überraschenden Zitat Bezug: «Die Wohnhäuser in der Stadt (Moskau) sind aus Holz gebaut, die Dächer mit Holzschindeln bedeckt, daher die mächtigen Brände. Doch diejenigen, deren Häuser abgebrannt sind, können sich neue verschaffen. Ausserhalb der Stadtmauer stehen auf einem besonderen Markt mehrere zum Aufbau fertige Häuser zur Ansicht bereit. Man kann sie billig kaufen und fertig stellen lassen. Das gekaufte Haus kann in zwei Tagen fix und fertig geliefert werden.»
Dieses Zitat, das so deutlich auf Vorfabrikation, Normierung und Standard verweist und deshalb an die «Balloon Frame Houses» von Chicago um 1900 erinnert, ist aber keineswegs ein neuzeitlicher Marktbericht, sondern die Reiseschilderung eines Deutschen von 1636 (A. Olearius, Reise nach Moskauvium). Woraus sich ergibt, dass die Fortschrittsvorstellung, Stein «überhole» allemal Holz, mit Vorsicht geprüft werden muss. Dennoch bleibt wahr, dass Holz mit seinen Wachstumsringen und seiner mehr oder weniger zylinderförmigen Gestalt des Stamms über Jahrhunderte hin (fast möchte man sagen: bis zu Alvar Aalto) nicht beliebige geometrische Form annehmen konnte - ganz im Gegensatz zum Stein, der meist wenig Äderung und deshalb wenig «mitgebrachte» Gestalt enthält, also zur Erzeugung geometrischer Form ungleich geeigneter ist.
Der baubesessene Zar konnte seiner Obsession 22 Jahre lang obliegen, bis zu seinem Tode 1725. In dieser Pionierzeit der Stadtvisionen hat er immer wieder neue Planer und Entwerfer angeworben - bis sich schliesslich deren Konzepte und deren erste Realisierungen in die Haare gerieten. Der Tessiner Domenico Trezzini aus Astano im Malcantone und der Franzose Alexandre Le Blond haben ihre Projekte 1716 und 1717 dem Zaren vorgelegt - was westeuropäisch gelesen bedeutet: unmittelbar nach dem Tod des Sonnenkönigs Louis XIV in Versailles (1715). Für André Corboz ist dieser Zusammenhang wichtig, denn seine These zum Projekt Le Blond heisst «Une Cité-Parc pour un Tsar-Soleil». Eine aus Gartengestaltung und Landschaftsarchitektur herausentwickelte Stadtidee für den Sonnen-Zar, oder, wenn man so will: eine Ellipse mit den beiden Brennpunkten Stadtverdichtung und parkartige Naturnähe. Das alles meisterhaft komponiert in die Deltalandschaft der Newa - Le Blond beherrscht sein Metier als Bote aus Versailles.
Trezzini wirkt da vergleichsweise bescheidener, vertraut dem Längsrechteck als Ordnungskraft und durchzieht die Wassili-Insel mit einem entsprechend winkeltreuen Kanalnetz. Womit er indessen ungleich näher an das Jugenderlebnis des Zaren herankommt, der doch in Amsterdam, wie erwähnt, das Verhältnis von Kanälen zu Stadthäusern als Idealbild wahrgenommen hatte. Woraus sich ein psychologischer Rösselsprung des Stadtgründers ergab: Zwar lobt er Le Blonds Projekt 1717 über alles, hat aber bereits Order erteilt zu den Kanalgrabungen im Sinne des 1716 vorgelegten Projekts von Trezzini - bricht deshalb das Gespräch mit Le Blond ab und tröstet ihn mit dem Auftrag für Palastbauten in Peterhof.
Eine Stadt braucht langen Atem, insbesondere eine künftige Hauptstadt als «Capitale ex nihilo». Weit über den Tod von Peter dem Grossen hinaus bleibt das Newa-Delta eine Stadt-Baustelle grossen Stils, das auch Heere von Spezialhandwerkern von weit her anzieht. Zu ihnen gehören die seit dem Mittelalter in ganz Europa gefragten Steinhauer aus dem Gebiet rund um den Luganersee. Von ihnen brachte es Trezzini zum Planer und Projektleiter des Zaren. Aus der langen Reihe seiner Nachfolger seien erwähnt: für den Spätbarock Bartolomeo Francesco Rastrelli, für den Klassizismus Iwan Starow sowie für das 19. Jahrhundert Carlo Rossi und Le Montferrant.
Uns interessiert, abschliessend, eine besondere Eigenheit von Wasserstädten wie Sankt Petersburg und Stockholm. Da sie von Fluten durchströmt sind, welche die bauliche Nähe auf Distanz halten, gewinnen sie Raum und Atem für die Innenansicht ihrer eigenen Wohnwelt. In besonders glücklichen Fällen - wie im Falle von Istanbul mit seiner Serail-Spitze oder im Falle von Sankt Petersburg mit seiner Landzunge der Strelka - bildet sich ein eigentlicher Vista-Punkt für die Innenlandschaft der Stadt heraus. Thomas de Thomon, ein Schüler von Ledoux, bekam 1805 den Auftrag, auf dieser spektakulären Landspitze die Börse zu errichten. Die feudale Agrargesellschaft des Zarenregimes hat diese Institution des frühindustriellen westlichen Bürgertums offenbar mit ebenso viel Respekt wie Reserve empfangen. Der Respekt erweist sich darin, dass der Börse dieser städtebaulich überragende Standort zugewiesen wird; die Reserve darin, dass der Neubau auf die Wassili-Insel gesetzt wurde, obgleich damals schon klar war, dass das künftige Stadtzentrum nicht dort, sondern südlich der Bolschaja Newa, auf dem Festland, sich bilden würde.
De Thomon vermag dem Standort Strelka künstlerisch Genüge zu tun. Denn er erkennt, dass ihn hier zwei Aufgaben erwarten: zunächst das Börsengebäude selbst (als flacher Giebelbau mit Umgürtung durch eine Kolonnade) - aber dann das andere, die Landzunge, wie ein Schiffsbug die Gewässer der Newa teilend: Wie konnte er diesen pflugförmigen Keil architektonisch zur Artikulation bringen? Was galt es zu feiern? Die Vista, die Ansichten einer nördlichen, neuen, gerade hundert Jahre alt gewordenen Stadt mit ihrem Wasser-Panorama. Der Architekt verwandelt die Landzunge in einen Sockel aus blassrötlichem Stein, dessen Uferwand geböscht ist, im selben Grad wie die Schrägwand einer Pyramide. Damit deutet er erstmals an, dass er sich nicht nur in der griechischen und römischen Formensprache auskennt (was damals selbstverständlich war), sondern zusätzlich in der eben erst wieder entdeckten, noch älteren ägyptischen Formenkultur. Dieselbe Schräge taucht auf in trapezförmigen Toren und in den Keilsteinen über den Fenstern der Börse. Das Motiv der Rampe findet sich auf ihren Längsseiten, wird aber dann zur Hauptform an der Landspitze selbst, wo eine halbrunde Böschung von einer parallel gerundeten, absteigenden Rampe bis auf Meeresniveau sinkt und wieder aufsteigt.
Was fehlt noch an diesem in ägyptisierten Stein umgegossenen Flusskeil? Masten, wie die eines Schiffes. De Thomon setzt in die geböschten Ecken des Podiums zwei mächtige bordeauxrote Rostra-Säulen, die sich mit strahlender Gebärde von dem Gelb und Weiss des Börsenbaus abheben. Man spürt: Hier, in der nördlichen Fremde, kann de Thomon Dinge wagen, die man ihm in Paris zerredet und abgeblockt hätte. Wer sich in der französischen Revolutionsarchitektur eines Ledoux und Boullée auskennt - die sich ja, wegen ihrer megalomanen Ansprüche, weitgehend mit dem Träumen auf Papier begnügen mussten -, staunt nicht wenig darüber, wie präzise de Thomon, als einstiger Student dieser Lehrer, zwei ihrer Botschaften von der Seine an die Newa zu transportieren weiss. Die eine lautet: Sprich als Architekt Ägyptisch, denn es ist die Ursprache der Menschheit. Die zweite: Zeige zugleich, dass du modern bist, indem du das ägyptisch Schräge in Rundungen überführst und mit der Kugel krönst. Was de Thomon in der ursprünglichen Fassung seiner Strelka-Spitze wörtlich befolgte: Zwei blanke Kugeln empfingen die anlegenden Schiffe und waren zugleich Kontrapunkt zu den beiden schwungvoll sich emporschwingenden Rostra-Säulen, die als Leuchttürme ihren Dienst taten.
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Wäre dies ein Band über Paris, Hamburg oder Zürich, er wäre wohl eher von fachwissenschaftlichem Interesse. Der Suche nach der «Seele» einer Stadt vornehmlich anhand literarischer Quellen hängt, zumal wenn sie sich im Paraphrasieren ergeht, etwas Betuliches an. Den Charakter einer Fleissarbeit kann auch das Buch von Nikolai Anziferow (1889-1958) über St. Petersburg nicht verleugnen, was es indes so aufregend macht, ist die Tatsache, dass es 1922 verfasst wurde, in einem Moment also, da eine jahrhundertealte Geschichte und urbane Kultur im Feuerofen der Geschichte verschwand. Innerhalb eines Jahrzehnts war aus St. Petersburg Petrograd und aus Petrograd Leningrad geworden, und die kommunistische Oktoberrevolution von 1917 bedeutete in der Konsequenz nicht weniger als die totale Entwertung all dessen, was bisher gewesen war. Einem wunden Tier gleich lag die Stadt in diesen Tagen, und durch den Tod zweier Kinder getroffen war Nikolai Anziferow persönlich, als er noch einmal die Schönheit und die Statur, den Mythos und die Magie St. Petersburgs beschwor. «Die Seele Petersburgs» ist das Produkt eines zweifachen Ausnahmezustandes. So wie die Eule der Minerva ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt, so malt der Autor das Panorama der widersprüchlichen Bilder, welche die Stadt umstellen, seit Alexander Puschkin sie 1833 in seinem Poem «Der eherne Reiter» als «unvergleichlich schönes und als todgeweihtes Gebilde, als Gegenstand massloser Bewunderung und eines Erschreckens über die menschliche Masslosigkeit» (Schlögel) gezeichnet hat.
Anziferows Buch des Abschieds liegt seit kurzem auf Deutsch vor. Während der Perestroika war der russische Reprint das hoch begehrte Objekt eines Wissensdurstes, der für manche so neu nicht war. «Die Seele Petersburgs» sei in den späten Sowjetjahren ein Geheimtipp gewesen, belehrt uns der Osteuropahistoriker Karl Schlögel in einem Begleittext, der den Rahmen eines Vorworts sprengt und sich zu einem Plädoyer für die Archäologie jener verlorenen Welten aufschwingt, die der Nihilismus in seiner realsozialistischen Version hinterlassen hat. Bereits in den späten sechziger Jahren habe sich diese Rückeroberung in der Subkultur angekündigt, als sich eine enterbte Generation daranmachte, die Geschichten hinter der offiziellen Geschichte Leningrads lesen zu lernen und den Geist der Stadt zu entdecken, wie er vor der Revolution, vor dem «grossen Terror», vor der Blockade geweht hatte. Die Utopie, die diese Menschen bewegte, war nicht die einer gloriosen Zukunft, sondern jene einer intimen Nähe, und sie war nicht mit den Helden der Arbeit bevölkert, sondern mit Verbannten oder Vernichteten, Entrechteten oder Ermordeten des Regimes. Mit passionierter Liebe zur Sache wurden die Waben des Gedächtnisses, die das System geplündert hatte, von einem Kreis von Kennern wieder mit lebendiger Erinnerung gefüllt.
Fast wäre Anziferow selbst den Weg des Verderbens und Vergessens gegangen. Die zwanziger Jahre waren seine produktivste Zeit als Historiker und Heimatkundler - es war, als habe er geahnt, dass ihm für seine Projekte nur eine Galgenfrist blieb. In den Abgrund, der sich 1929 mit der «grossen Säuberung» auftut, verschwindet er wie so viele Intellektuelle seiner Generation als Exponent des «alten» Denkens, und es beginnt eine Odyssee durch die Lager, in denen er das diabolische System des Gulag, aber auch den staunenswerten kulturellen Reichtum der russischen Gesellschaft kennen lernt. Wo immer sie konnten, versuchten die Häftlinge, die Zivilisation hochzuhalten, indem sie sich Lektüre organisierten und einander gegenseitig unterrichteten. Das berüchtigte Lager auf der Klosterinsel Solovki, so Schlögel, sei damals ebenso zur «Hauptstadt der russischen Intelligenz» geworden wie die riesige Baustelle am Weissmeer-Ostsee-Kanal - eine «Petersburger Gesellschaft en miniature am Polarkreis». Als Anziferow 1939 entlassen wird, steht ihm eine neue Prüfung bevor. Er selbst überlebt den Krieg, verliert aber einen Sohn, während eine Tochter von den Deutschen zur Zwangsarbeit verschleppt wird; erst 1948 wird der Vater erfahren, dass der Weg sie später weiter in die USA geführt hat.
Bis an die eigene düstere Gegenwart hat Anziferow sich in seiner Petersburger «Seelenkunde» herangeschrieben. Mit den Zeitgenossen Anna Achmatowa und Ossip Mandelstam, Andrei Belyi und Wladimir Majakowski teilt er das Bewusstsein der Einzigartigkeit St. Petersburgs, seines Reichtums, aber auch seiner Zerbrechlichkeit, wobei er nicht die Revolution, sondern den Fortschrittsfuror im Auge hat, der an der Substanz der alten Residenzstadt petrinischer, katharinischer und alexandrinischer Provenienz zu nagen beginnt. Die wilde Kommerzialisierung und das Baufieber nach der Jahrhundertwende, das sich in Jugendstil und Art nouveau ausdrückt, sieht er als Zeichen von Niedergang und Dekadenz. Der spätzeitlich nostalgische, nicht selten morbide Kult der Schönheit und der Form um 1900 belegt, wie sehr Schriftstellern und Künstlern bewusst war, dass die zerstörerische Stunde der Moderne geschlagen hatte.
St. Petersburg steht heute real, aber auch als Mythos neu zu erkunden. Anziferows Klassiker bietet einen unentbehrlichen Cicerone von Zitaten und Anspielungen - von der Gründung bis zur Zeit nach der Revolution. Getragen wird diese Revue durch die Denkfigur von der «Hauptstadt des tragischen Imperialismus», in der sich das Drama des Kampfes von Kultur und Natur, von Genie und Hybris, Allmacht und Ohnmacht abspielt, um am Ende in die Niederlage des Menschen zu münden. Anziferow verzichtet gewiss nicht zufällig darauf, diesen Gedanken auch politisch auszudeuten. Immerhin lässt die Formulierung tiefer blicken, es stehe mit St. Petersburg der «Kristallisationspunkt unserer Zivilisation» auf dem Spiel.
Dass nicht erst die Kommunisten einen universalistischen Herrschaftsanspruch erhoben, zeigt der Umstand, dass die Stadt sich in irgendeiner Form die Insignien fast aller grossen Zeiten und Reiche als Zitat aneignete - vom goldenen Zeitalter über Ägypten bis Rom. Es ist von merkwürdiger Ironie, dass eine Metropole, die sich die ganze Geschichte derart zu eigen machte, so aus der Welt herausfallen konnte. Vor hundert Jahren war St. Petersburg dabei, bei sich selbst anzukommen. Seither ist das Fremde im Eigenen ins Ungeheuerliche gewachsen. Was heute, nach der Katastrophe, an Arbeit des Sichtens, Rettens und Verstehens ansteht, ist nicht zu vergleichen. Die Wiederentdeckung des Wiederentdeckers Nikolai Anziferow kann nur ein erster Anfang sein.
Andreas Breitenstein
Nikolai P. Anziferow: Die Seele Petersburgs. Vorwort von Karl Schlögel. Aus dem Russischen von Renata von Maydell. Verlag Carl Hanser, München 2003. 294 S., Fr. 37.30.
In Neuauflage ist zudem wieder greifbar: Karl Schlögel: Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909-1921. Verlag Carl Hanser, München 2003. 703 S., Fr. 59.-.
Als Überblicksdarstellung zum Thema ist zudem erschienen: Erich Donnert: Sankt Petersburg. Eine Kulturgeschichte. Böhlau-Verlag, Köln 2000. 322 S., Fr. 42.-.
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Seit eh und je, sich selbst zur Feier, Schwimmen Wolken, flammengleich, dahin. Aus der Festung schaut der Engel freier In die Zukunft - Wolken machen Sinn.
Der blanke Blick ergründet aber nicht Die Dämmernisse, Träume, die noch kommen, Und wenn die letzte Nacht herunterbricht, Wird auch das Gold der Wolken mitgenommen.
1916
Aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold
17. Mai 2003, 02:19, Neue Zürcher Zeitung
Roald Mandelstam (1932-1961)
Роальд Чарльзович МАНДЕЛЬШТАМ
Die Geisterstadt
Das Frühlingsfest ist aus, vergangen - Und wieder steigt die Nacht herab, Erfüllt mich mit sonorem Bangen Um diese Stadt, die ich errichtet hab.
Das Blut der Sonnenuntergänge Stockt im Verlies der Finsternis, Und elegante Türme hängen Im Himmel, von der Nacht gehisst.
Die Geisterstadt gerät ins Beben, So auch der Schattenwald im Park. Vom blauen Frühlicht leicht benebelt, Erwarte ich nur Weh und Arg.
ca. 1953
Aus dem Russischen von Felix Philipp Ingold
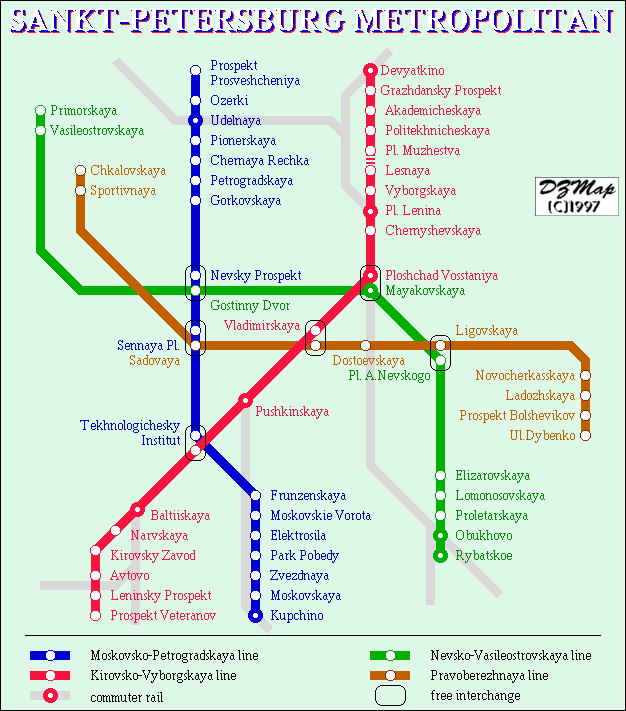
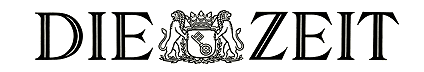
21/2003
Jubiläum
Mysterium des Nordens
Ein Streifzug durch wichtige Bücher zur Geschichte St. Petersburgs
Nur wenige St. Petersburger leben noch, die sich der Zeit erinnern, als ihre Vaterstadt das Machtzentrum des Zarenreiches war. Die meisten Gelehrten dieser Generation, die vor kurzem noch zur Erforschung des alten St. Petersburg maßgeblich beigetragen haben, sind bei den Feiern zum 300. Jahrestag nicht mehr dabei. Aus besonderem Grund seien zwei von ihnen hier genannt: zum einen der Nestor der russischen Literaturwissenschaft, Dmitrij Sergejewitsch Lichatschow (1906 bis 1999), auf der Admiralitätsinsel aufgewachsen, Überlebender des Stalinschen Lagersystems und der deutschen Blockade Leningrads, unermüdlich in der Fürsorge um das geistige Leben seiner Stadt, unanfechtbar auch als moralische Autorität; zum anderen Erik Amburger (1907 bis 2001), ein Deutscher, auf Wassili Ostrow geboren, aus dem roten Petrograd über Reval nach Deutschland entkommen, ein Genealoge enzyklopädischen Formats, hervorgetreten mit Standardwerken zur Wirtschafts-, Familien-, Konfessions- und Bildungsgeschichte Petersburgs. © Foto: Sabine Wenzel/Agentur Focus
Abschied von Leningrad
Lichatschow und Amburger werden hier genannt, weil ihr Beispiel auf eine deutsch-russische Sonderbeziehung verweist, die von St. Petersburg gestiftet wurde und die so fest gegründet war, dass sie selbst in den schlimmsten Kriegs- und Katastrophenzeiten nicht verloren ging. Niemand, die Russen selbst ausgenommen, war mit dieser Stadt von Anfang an enger verbunden als die St. Petersburger Deutschen. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts der Stadt wurde deren blühende Entwicklung ausschließlich von gelehrten Untertanen deutscher Zunge beschrieben. Wer mag und eine unversehrt gebliebene Universitätsbibliothek in seiner Nähe hat, kann sich einlesen in die großen historisch-topografischen Beschreibungen St. Petersburgs, die Johann Gottlieb Georgi (1790), Heinrich Storch (1794) und Heinrich von Reimers (1805) unter allerhöchster Protektion verfassten. Doch um das „Palmyra des Nordens“ zu preisen, waren die Russen des aufgeklärten Säkulums auf die pedantischen Deutschen nicht angewiesen. Für das Publikum erhebender war die russische Odendichtung – das hat der Konstanzer Slawist Riccardo Nicolosi kürzlich überzeugend dargetan –, eine literarische Gattung, die den Regeln antiker Panegyrik folgte und Städtelob und Herrscherlob miteinander verflocht.
200 Jahre später, als die Gorbatschowsche Perestrojka auch in Leningrad, der zweitgrößten Stadt des Sowjetreiches, neue Energien weckte, sollte es wieder zu einer sympathetischen Zuwendung zwischen Russen und Deutschen kommen. In St. Petersburg war die Neigung, Zukunft in der Vergangenheit zu suchen, besonders groß. Der Abschied von Leningrad und die Rückkehr zur alten, sakralisierten Namensform lagen nicht mehr weit voraus. Nach dem Ende der Zensur konnte man lang entbehrte Raritäten der älteren Stadtliteratur als Reprints oder Neuauflagen an jeder Straßenecke kaufen. Bewahrt werden sollte nicht allein das musealisierte Erbe St. Petersburgs, sondern auch jenes Mythengewebe, von dem die Stadt seit Menschengedenken überzogen ist. Historiker wünschten nichts dringlicher, als in bisher gesperrten Archiven Antworten auf Fragen zu finden, die sie vordem nicht einmal zu stellen wagten. Andere mühten sich, Geist und Seele, Metaphysik und Mystik der wundersamen Stadt zu retten und den „Petersburger Text“ der kultursemiotischen Schule auch. Die große Leningrader Enzyklopädie, das in sowjetischer Zeit maßgebende Nachschlagewerk, wurde von Grund auf revidiert.
Auf vulkanischem Gelände
Auch in Deutschland lebte damals das Interesse auf, die „Kulturhauptstadt Russlands“ neu zu entdecken. Man denke an die fulminante Essener Ausstellung von 1990 mit Meisterwerken aus der Leningrader Eremitage (deren hinreißender Katalog St. Petersburg um 1800 ohne Parallele blieb) oder an die eindrucksstarken Fotobände aus der Haupt- und Residenzstadt, die 1991, von russischen Experten kommentiert, bei C.H. Beck in München und DuMont in Köln erschienen. Nicht vergessen werden sollte auch, dass Jahr für Jahr in Deutschland Dissertationen entstehen, die die unterschiedlichsten Felder der St. Petersburger Stadtgeschichte zum Thema haben. Eine erste Orientierung erlaubt der Sammelband St. Petersburg, Leningrad, St. Petersburg. Eine Stadt im Spiegel der Zeit. Gewidmet wurde er Alexander Steininger, dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, der als Sohn deutscher Eltern mit sowjetischem Pass in Leningrad aufwuchs und das Grauen der deutschen Blockade überlebte.
An dem ersten und zugleich besten Buch über St. Petersburg wurde schon geschrieben, als Genosse Romanow noch in Leningrad regierte und das Paradeservice Katharinas II. bei Festgelagen auf die Tafel setzen ließ: Karl Schlögels großer Essay über die Stadt als Laboratorium der Moderne erschien 1988 bei Siedler – ein meisterhaftes Buch, von dem es zum Stadtjubiläum eine nun von Hanser betreute Neuausgabe gibt. Der Wiederkehr des Buches geht eine Hommage des Autors an die jubilierende Stadt voraus; in einer „bibliographischen Notiz“ ist festgehalten, wie intensiv die internationale Forschung an der Wiederentdeckung der Newa-Metropole beteiligt war. Der Text, dessen intellektuelle und sprachliche Brillanz manchen Fachvertreter vor 15 Jahren irritierte, blieb unverändert und wirkt so frisch und eigenwillig wie ehedem.
Schlögels Petersburg gehört zu den Edelsteinen der deutschen Russlandliteratur. Mit beispielloser Eindringlichkeit hat der damals 40-Jährige den Wandlungsprozess beschrieben, in den Russland Anfang des letzten Jahrhunderts hineingerissen worden war. St. Petersburg, das politische, ökonomische und intellektuelle Kraftzentrum dieser Erneuerung, schien dem Imperium eine Zukunft „jenseits des Großen Oktober“ zu verheißen. Die Kaiser- und Kasernenstadt wurde zur modernen Industrie- und Kulturmetropole, zur größten, die es im Norden Europas jemals geben sollte. Hier, auf vulkanischem Gelände, war eine junge, urbane Bürgergesellschaft dabei, ihre Energien zu erproben. Ihr wurde die Lebensluft entzogen, als nach dem Oktoberumsturz Lenins rote Kommissare kamen und das Zentrum Räterusslands (und des „Weltsozialismus“) in den Moskauer Kreml verlegten. Damit wurde die Entfaltung ziviler Kultur, die für den russischen Weg zur Moderne bis dahin charakteristisch gewesen war, gewaltsam abgebrochen.
Der zweite neue Titel, auf den hier verwiesen sei, ist ein lange vergessener Klassiker der russischen Stadtgeschichte und heißt Die Seele Petersburgs. Das Buch, von Schlögel eingeleitet und von Renata von Maydell kongenial übersetzt, stammt von Nikolai Anziferow, einem Kunstpädagogen und Lagerinsassen der Stalinzeit. Es entstand in den Bürgerkriegsjahren, als die riesige Stadt zur steinernen Ödnis verkommen war, malträtiert von Hunger, Kälte und Terror. In St. Petersburg, der „Stadt des tragischen Imperialismus“, hatten 1914 mehr als zwei Millionen Menschen gelebt. Als das Buch 1922 erschien, war nur ein Drittel davon in Petrograd geblieben.
In dieser Notzeit versuchte Anziferow, den Genius Loci St. Petersburgs zu fassen, die Stadt nicht als Luftgebilde, sondern in ihrer sinnlich fassbaren Individualität. Mit der Physiognomie wollte er zugleich den Geist beschreiben, dem die „Schöpfung Peters“ ihr Charisma verdankt: den „Stadtkörper“ als Ganzes, aus der Vogelperspektive betrachtet, als lebenden Organismus, von Menschenhand geschaffen, umgeben von Wasser, Landschaft und gestalteter Natur. Um die Wahrnehmungen anzureichern, nahm er Literatur und Poesie zu Hilfe und führte die Bilder vor, die russische Dichter von St. Petersburg vermittelt hatten.
Unverwechselbare Individualität
Damit gewann er eine historische Perspektive eigener Art: Sie beginnt mit der Panegyrik des 18. Jahrhunderts, führt zu den Petersburger Erzählungen Puschkins und Gogols hin, zu deren schwankenden Empfindungen zwischen dem Mysterium des Ehernen Reiters und der Angst und Not des kleinen Mannes. Schließlich beschreibt er Dostojewskijs verhassten Moloch St. Petersburg, mit Katastrophenahnungen und Untergangsprognosen, die von einer Plejade prominenter Symbolisten übernommen und ins Apokalyptische gesteigert werden. Auch das St. Petersburg der Akmeisten-Schule, mit der jungen Achmatowa und Ossip Mandelstam, werden einbezogen. In seinen folgenden Arbeiten ist Anziferow in dieser Richtung fortgegangen. Sie galten der Entwicklung einer wissenschaftlichen Exkursionskunde, bei der literarische Spaziergänge, strategisch wohl durchdacht, ins Zentrum rückten. Noch heute sind in den Techniken der St. Petersburger Stadttouristik seine Anregungen zu spüren.
Was könnte im Säkularjahr willkommener sein als eine „Kulturgeschichte“ St. Petersburgs, konzentriert auf die Zarenzeit, verfasst von einem deutschen Russlandhistoriker, der seine Kompetenz durch viele einschlägige Bücher beglaubigt hat? Erich Donnert aus Halle, in DDR-Zeiten auch im Westen respektiert, hat das Wagnis auf sich genommen, für einen breiten Leserkreis zu schreiben. Doch ob das, was er abgeliefert hat, das Publikum in der gewünschten Form bedienen kann, steht dahin. Vorgelegt wird ein uninspirierter, auf die Akkumulation von Fakten und Daten bedachter Text, den aufzunehmen die Aufmerksamkeit eines Examenskandidaten verlangt. Das sorgfältig gearbeitete Personenregister umfasst etwa 800 Namen; der Leser kann sie in der Regel nur registrieren. Petersburg in der russischen Literatur wird auf 13 Seiten abgehandelt. Das Kapitel über den Kulturphilosophisch-literarischen Diskurs am Ausgang der Moderne wirkt wie eine lexikalische Kompilation von Kurzbiografien der geistigen Elite. Kein Reiseführer würde sich gestatten, so schlecht reproduzierte Abbildungen zu bringen wie dieses Buch. Stadtpläne fehlen. Und vor allem: St. Petersburg in seiner unverwechselbaren Individualität kommt nicht ins Bild.
*
Riccardo Nicolosi: Die Petersburg-Panegyrik
Russische Stadtliteratur im 18. Jahrhundert; Peter Lang, Frankfurt a. M., 2002;
208 S., 39,– ¤
* St. Petersburg – Leningrad – St. Petersburg
Eine Stadt im Spiegel der Zeit; hrsg. von Stefan Creuzberger, Maria Kaiser, Ingo
Mannteufel, Jutta Unser; DVA, Stuttgart/München 2000; 350 S., 22,– ¤
* Karl Schlögel: Petersburg
Das Laboratorium der Moderne, 1909 – 1921; C. Hanser Verlag, München 2002; 702
S., 34,90 ¤
* Nikolai P. Anziferow: Die Seele Petersburgs
Aus dem Russischen von Renata von Maydell; C. Hanser Verlag, München 2003; 293
S., 21,50 ¤
* Erich Donnert: Sankt Petersburg
Eine Kulturgeschichte; Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien 2002; 322 S., 24,90 ¤

Die Hyperboreer sind Menschen, die jenseits des Boreas, des Nordwinds, leben. In ihrem Land überwinterte bekanntlich Apollo, bis er von Amis zum Mond geschossen wurde." Diese Gedichtzeile gehört Konstantin Vaginov (1899-1934), einem der vollkommensten russischen Lyriker, der in Deutschland eher durch seine apokalyptisch-humoristischen Petersburger Romane (zum Beispiel "Bocksgesang", 1927, auf Deutsch 1999 erschiene im Johannes Lang Verlag) mehr oder weniger bekannt ist. Das wundert mich nicht: Sein apollinischer Klang ist schier unübersetzbar, mir ist es auch nicht ganz gelungen da oben, im Titelvers.
Eine Insel: Sankt Petersburg wurde immer so verstanden, und immer verstand es sich selbst so: als eine Insel im Russischen Meer. Das bedeutet nicht unbedingt unrussisch - ohne Meer gibt es auch keine Inseln. Es bedeutet anders-russisch, eine andere Möglichkeit, russisch zu sein - nicht die bessere, nicht die schlechtere, eine andere eben. Eine neue. Zu diesem Zweck hat Peter der Große diese Stadt vor 300 Jahren gebaut - als die Neue Welt, als das Neue Rußland. Selbst nannte er sie schlicht und einfach "mein Paradies". Eine Stadt für die neuen Menschen, so groß wie er, oder vielleicht sogar noch größer. Für die noch nicht geborenen Riesen.
Eines der verbreitetsten und beliebtesten Stereotype, Petersburg sei eine europäische Stadt im asiatischen Land, hat eigentlich nie gestimmt und ist vordergründig ein Produkt intellektueller Faulheit und Wunschdenkens, wobei wir die widerliche und selbstgefällige Gewohnheit, das Wort "europäisch" als Synonym für zivilisiert, fortschrittlich, hygienisch, überlegen usw. zu benutzen, jetzt lieber außer Acht lassen.
Petersburg ist keine "europäische" Stadt und ist es nie gewesen. Nur wenige haben das erkannt, so Lewis Carroll, der Unvoreingenommene, der sich nur für Mathematik, kirchliche Rituale und das Fotografieren von kleinen imaginär entkleideten Alices (mit freundlicher Erlaubnis der Eltern, versteht sich) interessierte und für alles andere gleichgültig-offen war. Im Jahre 1867 fuhr er auf seiner ersten und letzten Reise außerhalb Britanniens von London durch Frankreich, Belgien, Deutschland (Köln, Berlin, Danzig, Königsberg) nach Russland. In seinem Tagebuch einer Reise nach Russland (auf deutsch erschienen bei Insel vor drei Jahren) beschreibt er den ersten Eindruck von Sankt Petersburg: "Die enorme Breite der Straßen (von denen die zweitklassigen breiter zu sein schienen als irgend etwas in London), ... die enormen beleuchteten Aushängeschilder über den Geschäften und die riesigen Kirchen mit ihren blaubemalten und sternenbedeckten Kuppeln, das verwirrende Geplapper der Einheimischen - all das trug zu den Wundern unseres ersten Spaziergangs in Petersburg bei."
Und an anderer Stelle: "Die Entfernungen sind hier enorm: Es ist, als ob man in einer Stadt für Riesen umherginge." Unser kleiner Gulliver hat in dieser "Stadt für Riesen" nichts gesehen, was er für "europäisch" hätte halten können. Dabei hatte er gerade ganz Europa durchfahren. Sankt Petersburg war das New York City des 19. Jahrhunderts - befremdlich, neuartig, unbegreiflich, riesig. Eine Stadt für Riesen, eine Stadt für sich.
Für sich - auch im buchstäblichen Sinne. Keine andere Stadt, die ich kenne, pflegt eine derartig einseitige Beziehung zu ihren Bewohnern. Sie werden von Petersburgs Ausstrahlung vereinnahmt, transformiert, zu einem besonderen Menschenschlag gemacht, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Im 20. Jahrhundert wurde das besonders anschaulich, als die von der Revolution, dem kommunistischen Terror und dem Zweiten Weltkrieg dreimal nahezu ausradierte Stadtbevölkerung dreimal nahezu vollständig durch zugezogene Menschenmassen ersetzt wurde.
Die Stadt selbst ändert sich im Grunde nicht, sie nimmt keine Einflüsse von ihren Bewohnern auf. Sogar wie wir sie benennen, lässt sie kalt: Dreimal wurde sie innerhalb eines Dreivierteljahrhunderts umbenannt - und hat sie das bemerkt? Wohl kaum. Es scheint so, als habe sie, wie die Katzen in T.S. Eliots Buch, das zur Vorlage für ein gewisses Musical missbraucht wurde, einen eigenen, unaussprechlichen Namen für sich, den wir nie erfahren werden.
Und ihr Einfluss auf uns scheint auch nicht gewollt zu sein, eher ist er ein Nebeneffekt, eine Nebenwirkung ihrer Ausscheidungen. Diese Stadt interessiert sich nicht für die Menschen, die sie bewohnen und stellt ihnen frei, sich für sie zu interessieren, oder auch nicht. Sie wurde nicht für gewöhnliche Menschen gebaut, und sie lebt auch nicht für gewöhnliche Menschen. Wenn Petersburg sie quält, diese Gogol'schen Kleinbeamten und Dostojewskijschen Studenten, dann allein durch seine Gleichgültigkeit. Im Prinzip kann die Stadt ganz gut ohne Bewohner auskommen, und in den menschenleeren Zeiträumen wird sie noch schöner, noch größer, noch großartiger.
"Der Platz vor dem Winterpalast", schreibt Joseph Roth ("Reise nach Russland", 1995 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch) über das nach dem Bürgerkrieg fast entvölkerte Petersburg, "ist weit, und der Schnee verwischt seine Grenzen. Er ist als Platz so unermeßlich, wie Rußland als Reich unermeßlich ist. Durch die Fensterscheiben, die eine gelbliche Tönung haben, sieht man auf ihn wie auf einen erstarrten See. Eine Wehmut aus Stein und Eis steigt aus ihm auf wie Nebel aus einem lebendigen. Menschen, die ihn überquerten, sehen winzig aus, wie verkleidete Streichhölzer." Ich glaube, diese Stadt empfindet ihre viel zu kleinen Menschen wie ein Wal irgendwelche auf oder unter seiner Haut lebende Insekten: Juckt es nicht zu sehr, dann gut so; werden sie abgeschüttelt oder zerquetscht, dann kommen andere.
Petersburg ist kein "Wohngebiet", es ist ein Wesen mit eigenem Bewusstsein, das wir nicht verstehen, und es ist von einem eigenem Willen, den wir nicht kennen. Deshalb kann man nicht in Petersburg leben - nur neben Petersburg. Man steht Schlange entlang der sich bewegenden Treppen, um ins Innere von Petersburg zu gelangen, aber die Treppen rollen immer wieder zurück, an die Oberfläche. Dabei gibt es daran nichts Trauriges, nichts Erniedrigendes, neben jemand, neben etwas zu leben, das sich einen Teufel um dich schert. Das macht aus einem Petersburger, in erster Linie einem Petersburger Dichter, eine stolze Geisel der Ewigkeit.
Du weißt, dass sich nach deinem Abgang nichts prinzipiell ändert - die Newa wird weiter durch ihren grauen Pelz goldene Funken jagen, die Paläste werden Schulter an Schulter stehen, dazwischen gibt es keine Lochräume für neue Paläste, die riesigen Plätze werden riesig bleiben, schwarz-weiß-gelb im Winter, grau-grün-golden im Sommer. Diese Stadt, das 300-jährige Kind unter den ewigen Städten, wird in ihrem Äußeren, und schon sowieso in ihrem Inneren, entweder immer so bleiben, wie sie ist, oder, Gott bewahre, ganz verschwinden.
Moskau oder Berlin oder Paris ändern ihr Antlitz bei jedem Wechsel der Umstände. Menschen ändern die Städte. Wer heute nach Moskau kommt, das er vor 15 Jahren als die sowjetische Hauptstadt kannte, erkennt sie nicht wieder, diese wilde Mischung aus Los Angeles und Istanbuler Bazar. Wenn du in 300 Jahren zurück nach Petersburg kommst, bleibt das Wesentliche unverändert. Petersburg bleibt. Deshalb glaubt ein Petersburger Dichter, dass er etwas Bleibendes hinterlassen kann. Und muss. Er hat ein Beispiel, eine (einseitige) Bekanntschaft mit der Ewigkeit. Er weiß, dass sie existiert - aus täglicher Berührung.
Eine Insel? Ja, eine lebendige Insel. Ein Walrücken im hyperboreischen Meer. Der Rücken eines Wals, der sich weigert, uns Jonasse zu schlucken. Ob man so groß wie Peter der Große sein muss (204 Zentimeter), oder noch größer, um verschluckt werden zu dürfen? Ob der Wal irgendwann aufbricht und durch Rußland schwimmt, vom Baltischen Meer bis zum Schwarzen, vom Schwarzen Meer bis zum Pazifik, wie Zar Peter es hoffte? Das wissen wir nicht. Petersburg ist noch ein Kind, das in seinem Schaukelbett liegt und am bleiernen Euter des hyperboreischen Himmels saugt.
Oleg Jurjew (geb. 1959 in Leningrad) ist Lyriker, Dramatiker, Romancier, Essayist. Auf deutsch erschien zuletzt "Spaziergänge unter dem Hohlmond" (2002, Suhrkamp). Im Herbst 2003 erscheint bei Suhrkamp sein Roman "Der neue Golem oder Der Krieg der Kinder und Greise".
Artikel erschienen am 17. Mai 2003
Christine Hamel: Puschkinkult in weißen Nächten.
Picus, Wien. 132 S., 13,90 EUR.
Eva Gerberding: St. Petersburg. DuMont, Köln. 96 S., 6,95 EUR.
Elena Nowak, Anja Otto, Vadim Sergeev: St. Petersburg entdecken. Trescher, München. 250 S., 13,95 EUR.
Michaela Riese: St. Petersburg. Merian, Köln. 128 S., 7,95 EUR.
Ingrid Schalthöfer: St. Petersburg. Insel, Frankfurt/M. 232 S., 10 EUR.
Natalja Nikolajewa: Grüß den Kanzler schön von mir. Briefe und Geschichten aus St. Petersburg.
A. d. Russ. v. Friederike Meltendorf.
Berlin Verlag, Berlin. 160 S., 8,90 EUR (Sept.).
Sonntag, 1. Juni 2003 Berlin, 12:18 Uhr

The Great Catharine Palace - Saint Petersburg
Sankt Petersburg kann man zu seinem 300. Geburtstag ein Kompliment machen, das das Gegenteil zur üblichen Geburtstagshöflichkeit ist: "Wer hätte denken können, dass Sie so jung sind. Ich hätte Sie auf ein paar Jahrtausende älter geschätzt." Dies gilt weniger der äußeren Gestalt der Stadt, deren breite Perspektiven, barocke und klassizistische Paläste und mit Laternen, Löwen oder Säulen verzierten Brücken zeitlos anmuten. Es ist vielmehr die Biografie dieser Stadt, ihre mythische Ladung, die Staunen erweckt: In dem kleinen zeitlichen Rahmen von drei Jahrhunderten hat sich ein Maß an Geschichte ereignet, dass, wer hier lebt, das Gefühl hat, dieser Rahmen könnte jede Sekunde bersten. Die Stadt hat eine innere Spannung, die schnell zu spüren, doch schwer zu begreifen ist. Nikolai Anziferows "Die Seele Petersburgs" ist ein gelungener Versuch, sich dem Geheimnis der Stadt zu nähern.
Nikolai Anziferow (1889-1958) war kein geborener Petersburger. Aber als er 1908 in die damalige Hauptstadt kam, wurde er von der Stadt, die er als "das russische Athen" bezeichnete, ergriffen. Für Russland war dies die Zeit der begeisterten Entdeckung der ästhetischen Werte und Welten im eigenen Land. Künstler brachten aus Italien und Frankreich einen forschenden, liebenden Blick für die eigene, russische "Antike" mit. Anziferow fand in dieser gewaltigen Entdeckungsarbeit Beruf und Berufung.
"Die Seele Petersburgs" ist zwischen 1919 und 1922 entstanden, in einer unruhigen, tragischen und seltsamen Zeit. Alles, was den Alltag einer großen Metropole bestimmte, war verschwunden. Die Fabriken standen still, es wurde ruhig wie auf dem Land, die Luft war rein geworden. In den Straßen wuchs Gras, Ziegen weideten zwischen den Portiken. Man wusste nicht, ob im Leben der Stadt eine Pause eingetreten war oder ihr Ende kam. Aus zahlreichen Zeugnissen jener Zeit ist jedoch auch bekannt, dass in Petersburg - inmitten von Zerrüttung, Kälte, Hunger - ein blühendes, fieberhaftes geistiges Leben erhalten blieb.
"Petersburg ist die Stadt des tragischen Imperialismus" - so die zentrale Idee und der berühmteste Satz des Buches. In einer für die damalige Wissenschaftssprache charakteristischen Wortwahl formulierte Anziferow diesen Begriff, dessen Bedeutung nicht mit dem marxistischen Terminus des Imperialismus gleichzusetzen ist. "Tragischer Imperialismus" ist eher eine lyrisch-philosophische Formel, der bildlichen Sprache eines Wissenschaftsdichters entsprungen. Sie bedeutet für Anziferow der immerwährende Widerspruch zwischen der Logik der Geschichte und dem Schicksal eines einzelnen Menschen: "Man wird kaum eine andere Stadt auf der Welt finden, deren Geburt mehr Opfer gefordert hatte als das Palmyra des Nordens. Petersburg ist wahrhaftig eine Stadt auf Menschengebeinen. Hier berichtet alles von dem großen Kampf mit der Natur."
Immer wieder vergleicht Anziferow die Grausamkeit, die an der Wiege Petersburgs stand, mit den antiken Überlieferungen: "Die graue Vorzeit kennt die Darbringung von Menschenopfern bei Grundsteinlegungen, und bis heute finden Archäologen die Knochen von Menschenopfern unter den Mauern antiker Städte."
Petersburg wurde nicht in grauer Vorzeit geboren. Es wurde von modernen Menschen mit modernen Maßstäben gemessen. Anziferow betrachtet die Bilder Petersburgs in der russischen Literatur. Das unheilvolle, widersprüchliche und tragische Petersburg entdeckte erst das 19. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert war die Zeit der feierlichen Ode: Die Stadt des großen Peters wurde besungen - von den großen Dichtern Lomonossow und Derzhawin würdig und wundervoll. Das erste komplexe Petersburg-Bild wurde von Alexander Puschkin geschaffen, über den Anziferow schreibt, dass er so sehr als Schöpfer des Bildes von Petersburg erscheine wie Peter der Große, der Bauherr der Stadt selber, und dass er der letzte Sänger der hellen Seite von Petersburg gewesen sei.
Puschkins Werk enthält alle Motive, die in Petersburg-Texten nach ihm erscheinen und die Anziferow verfolgt: das mystische Petersburg der Romantiker; das nicht ganz geheure Petersburg Gogols; Petersburg als Mittelpunkt des Streites zwischen Westlern und Slawophilen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verlor die Stadt vorübergehend ihre mystische Ausstrahlung und wurde zum Bild einer langweiligen Beamten- und Kleinbürgerwelt, in der die "naturalistische Schule der Literatur" nach kleinen Schicksalen und großen Gefühlen Ausschau hielt. "Das ist dermaßen gewöhnlich und prosaisch", so Dostojewski, "dass es fast schon wieder fantastisch wird."
Anziferow fühlt sich regelrecht gekränkt, wenn ein großer Schriftsteller keine Liebe zu Petersburg aufbrachte. So würdigt er den Scharfsinn, mit dem Dostojewski die Stadt entdeckte, ist aber unzufrieden, weil Dostojewski die gewinnenden Seiten "unserer Stadt" fern blieben. Mit großer Genugtuung bemerkt Anziferow die Bereicherung des Bildes Petersburgs im aufgehenden 20. Jahrhundert. Andrej Belyj, dem Schöpfer des neuen mystischen Gesichtes der Stadt, verzeiht er sogar eine gewisse Moskauer Feindseligkeit gegenüber Petersburg, da Belyj es zum Held eines Romans machte und die Stadt als überpersönliches Wesen betrachtete.
"Die allerfantastischste Stadt auf der Welt", sagt Anziferow. Jeder, der diese Stadt kennt, kann dem nur zustimmen. Die mehr als achtzig Jahre, die seither verflogen sind, haben daran nichts geändert.
Nikolai Anziferow: Die Seele Petersburgs. A. d. Russ. v. Renata von Maydell.
Hanser, München. 294 S., 21,50 EUR.
Artikel erschienen am 31. Mai 2003
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Frankfurt am
Main, 29.05.03
![]()
Direktiven
![]()
Die St.
Petersburg-Feiern
![]()
Von Alia Begisheva![]()
Willkommen in
"Venedig des Nordens", dem schönen Sankt Petersburg! Der ehemalige KGB-Chef lädt
zum 300. Geburtstag seiner Heimatstadt ein. Willkommen zum großartigen Fest, bei
dem der russische Geheimdienst und die Miliz, demoralisiert durch die 13 Jahre
postsowjetischer Demokratie, endlich wieder zuschlagen werden. Fühlen Sie sich
wohl bei diesen wichtigen Feierlichkeiten, zu denen 48 Staatspräsidenten geladen
sind, aber bei denen sich manch ein Bürger der Stadt an die Zeit der Belagerung
im Krieg mit Hitler-Deutschland erinnert. Willkommen in der russischen
Kulturhauptstadt, deren Hotelbetten nicht einmal für alle Begleiter der
hochrangigen ausländischen Staatsdelegationen ausreichen. Zeigen Sie beim
Spaziergang entlang der mit Steuergeldern renovierten Fassaden unaufgefordert
Ihren Personalausweis, denn alle Boulevards werden gut bewacht oder gar gesperrt
sein, genauso so wie der Flughafen und manch eine Zufahrtsstraße.
Besuchen Sie die Hauptstadt des imperialen Russlands, in der keiner der Aufsehen
erregenden Politmorde der vergangenen Jahre aufgeklärt, dafür aber im Vorfeld
des Jubiläums jede sich im Umlauf befindliche Waffe gezählt, jeder Vorbestrafte
aufgelistet und jede Wohnung in den Häusern gründlichst durchsucht werden
konnte, an denen die Luxuskarossen mit hochrangigen Gästen aus dem Ausland
vorbei fahren werden. Überzeugen Sie sich davon, dass die Straßen schon Tage im
voraus gesäubert worden sind von Anti-Jubiläums-Aktivisten, Obdachlosen,
Straßenhunden und anderem Müll.
Aber wie konnte - fragen Sie - der ganze Dreck, der jahrzehntelang an manchen
Stellen hartnäckig gehortet wurde, innerhalb von wenigen Tagen einfach so
verschwinden? Seien Sie sicher - auch diese Stellen sind den entsprechenden
Abteilungen bestens bekannt. Deshalb ragt an besonders unansehnlichen Ecken der
allein für die Dauer der Feier errichtete weiß-blaue Betonzaun empor, zwei Meter
hoch, hier und da fünf Kilometer lang. Fühlen Sie sich in der Wiege der
Oktoberrevolution so sicher wie bei Putins daheim!
Freuen Sie sich auf das Fest, dessen Gerüchteküche den Krieg in Tschetschenien
verblassen lässt. So kann man dieser Tage in St. Petersburg hören, dass jede
Menge der 40 Milliarden Jubiläumsrubel (ca. 1,18 Milliarden Euro) von der
Stadtverwaltung veruntreut wurde, und dass die ganzen Obdachlosen unterwegs nach
Nowosibirsk sind. Oder dass die St. Petersburger, die anlässlich der
300-Jahresfeier ganz freiwillig ins Auto steigen und auf die Datscha fahren, an
den Stadtgrenzen eine Flasche Wodka geschenkt bekommen. Wahrscheinlich durch so
viel Fürsorge gerührt, haben die Bewohner der Stadt in Anlehnung an das
bekannteste russische Schimpfwort, das ganze drei Buchstaben lang ist, einen
markanten Namen für das Fest gefunden: 300 - ein Wort aus drei Ziffern.
Und das Wetter? Es wird fantastisch sein. Die russische Regierung hat mehr als
700 000 Euro zur Verfügung gestellt, damit die Luftwaffe die Regenwolken einfach
wegdonnert.
Werfen Sie einen Blick auf die Werbebanner, die quer über die Straßen St.
Petersburgs gespannt, so seltsam an die guten alten Sowjetzeiten erinnern. Nicht
"Der Kommunistischen Zukunft entgegen!" steht dort jetzt, sondern "Der
300-Jahresfeier entgegen!" Die Bürger werden dazu aufgefordert, nicht den
Fünfjahresplan zu erfüllen, sondern zu feiern: "Prasdnik budet!", ist da zu
lesen, "Es wird ein Fest!", koste es, was es wolle!
Übrigens, verfolgen sie aufmerksam die kritische Berichterstattung aus St.
Petersburg in den russischen Medien. Denn die Journalisten sind von der
Regierung unmissverständlich dazu aufgerufen worden, objektiv zu berichten. Ein
St. Petersburger Web-Designer hat schon Mal im Vorfeld eine persönliche
Verwarnung aus dem Gouverneursamt erhalten. Oleg Kuwajew ist Autor einer
Trickfilmreihe im Internet, die wegen ihrer bissigen Kritik an der russischen
und Petersburger Realität so beliebt wurde, dass seit neuestem einige Folgen
auch im Fernsehen ausgestrahlt werden.
Masjanja, ein Mädchen mit Melonenkopf und kurzem blauen Röckchen, auf Anhieb
nicht als solches zu erkennen, ist die Kult gewordene Hauptfigur. Mit ihrer
alternativen "Stadtführung" hat Masjanja den Gouverneur von St. Petersburg
maßlos geärgert. Über die verdreckten Kanäle erzählt Masjanja den Touristen, vom
Ölfilm der Newa und den Babuschki, die die Schätze der Ermitage für 100 Rubel im
Monat bewachen. Masjanja, diesem haar- und zahnlosen Wesen, sei diese Einladung
nach St. Peterburg gewidmet.
Frankfurt am Main, 29.05.03
![]()
Touristen mit Videokamera machen sich
in Petersburg verdächtig
Zum 300. Geburtstag erlebt die ehemalige russische Hauptstadt Sicherheitsvorkehrungen wie noch nie
Von Florian Hassel (Sankt Petersburg)
Es waren gleich
mehrere Offiziere, die Swetlana Botlitsch klar machten, dass geschäftliche
Interessen beim 300. Stadtgeburtstag von Sankt Petersburg eine untergeordnete
Rolle spielen. Die Offiziere des Föderalen Wachdienstes, der Leibwache von
Präsident Wladimir Putin, verkündeten, die Immobilienmaklerin müsse ihr Büro im
Petersburger Zentrum zwei Wochen lang schließen, weil es an der Fahrtroute
offizieller Feiergäste liege. Botlitschs Hausnachbarn vom Roten Kreuz erhielten
bereits Besuch von Scharfschützen, die sich dort einquartieren werden. Teile der
Stadt sind schon seit Beginn der Feiern am 23. Mai für den Autoverkehr gesperrt.
Doch wenn am Wochenende gut 45 Staats- und Regierungschefs mit einem Gefolge von
bis zu 15000 Personen in der feiernden Stadt einfliegen, erlebt Petersburg
Sicherheitsvorkehrungen wie noch nie.
Ein gigantisches Feuerwerk und eine Lasershow gehören zu den Höhepunkten der
Feierlichkeiten. Putin und der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder werden
außerdem das rekonstruierte Bernsteinzimmer eröffnen.
In den vergangenen drei Monaten hat die Polizei 12000 Baustellen und 40000
Häuser durchsucht: nach Bomben und möglichen Terroristen. Obdachlose wurden
vertrieben, weil sie das Feierbild stören könnten. Bereits Mitte Mai hatte die
Polizei über 800 Menschen deportiert, sagte deren Sprecher Leonid Bogdanow. Und
auch als schwierig bekannte Teenager wurden vorsorglich in Sommerlager gebracht.
Sergej Tawatjenna, Indisch-Dozent an der Petersburger Lomonossow-Universität,
berichtete, der Zugang zur Universitäts-Insel sei zwei Wochen lang vollständig
gesperrt: "Wir sollen das Semester verkürzen und ausfallende Examen nachholen.
Aber keiner weiß, wie."
Der Petersburger Parlamentarier Michail Amossow von der liberalen Jabloko-Partei
hält viele Einschränkungen für "normale Maßnahmen bei einem Ereignis von diesem
Rang". Die letzte Zählung habe 45 Staats- und Regierungschefs aufgelistet, die
nach Petersburg kommen wollten, so Amossow. "Allein US-Präsident George W. Bush
rückt mit einem Gefolge von 600 Mann an." Um sich die Aufgabe des Empfangs so
vieler prominenter Gäste zu erleichtern, erklärte Russlands Verkehrsminister
kurzerhand, Petersburgs Flughafen Pulkowo werde auf dem Höhepunkt der Feiern
vier Tage lang nur VIPs empfangen, für alle normalen Passagierflugzeuge soll er
gesperrt bleiben.
Wer die Bestimmungen per Bahn austricksen will, bekommt in Moskau nur dann eine
Fahrkarte, wenn er einen Wohnsitz in Sankt Petersburg nachweisen kann. "Ich weiß
nicht, wer den Behörden das Recht gibt, nur wegen des Geburtstages russische
Gesetze zu brechen und uns so das Recht auf Bewegungsfreiheit zu nehmen", sagt
Irina Fiege von der Menschenrechtsorganisation Memorial.
"Um die letzten Obdachlosen aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen, wird
unsere Polizei sie wahrscheinlich festnehmen, zehn Tage lang ,zur Feststellung'
der Persönlichkeit festhalten und dann wieder freilassen", sagt Oleg Wjugin von
der Rechtsorganisation Graschdanskij Kontrol ("Bürgerkontrolle"). Auch
Kaukasier, Armenier, Aserbaidschaner und andere dürfen sich der Aufmerksamkeit
der Polizei sicher sein. Der Polizeichef ermahnte die in der Stadt Ausharrenden
per Flugblatt, jeden Tschetschenen zu melden, der einen neuen Mietvertrag
unterschrieben habe. "Außerdem sollen alle gemeldet werden, die historische
Gebäude übermäßig lange mit Videokameras oder Fotoapparaten aufnehmen", liest
Maklerin Botlitsch aus dem Flugblatt vor. "Ich stelle mir schon vor, wie
verdutzt die Touristen sein werden, wenn die Polizei sie beim Filmen der
Eremitage verhaftet."
Auch dafür, dass die hohen Gäste nur die schönen Seiten Petersburgs zu sehen
bekommen, ist gesorgt. Ende April begannen die Baubehörden an der Straße vom
Flughafen Pulkowo zum prächtig renovierten Konstantinowskj-Zarenpalast mit
hektischen Arbeiten: Die Bauarbeiter zogen einen zwei Meter hohen Zaun hoch,
damit die hohen Gäste nicht die teilweise mehr als 100 Jahre alten,
heruntergekommen Holzhäuser und Schuppen in den Dörfern sehen. Dorfbewohnerin
Alexandra Laar etwa richteten die Beamten aus, sie solle ihr Haustor vom 20. Mai
bis 1. Juni am besten nicht öffnen, berichtete sie der Saint Petersburg
Times. Einige offenbar als besonders schäbig empfundene Geräteschuppen
wurden kurzerhand niedergebrannt. Gennadij Lebedew, Chef des Baukomitees von
Strelna, sieht das Wirken der staatlichen Bauarbeiter skeptisch. "Wenn wir
dieser Logik folgen, müssen wir die Hälfte Russlands niederbrennen."
Frankfurt am Main, 29.05.03
Petersburger Versprechen
Von Karl Grobe![]()
Was Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Gast Hu Jintao in
Moskau beredet haben, hat gute Aussichten, in das Welterbe der guten Absichten
aufgenommen zu werden. Die Welt muss multipolar sein, um beständig und
vorhersehbar bleiben zu können; ihre Ordnung muss auf der Basis leicht
verständlicher und anwendbarer völkerrechtlicher Regeln beruhen; sie muss allen
Menschen Frieden, Entwicklung und Nutzen bringen. Das ist die Botschaft, so
ausgesprochen in Moskau bei Hu Jintaos erstem Auslandsauftritt als Pekings
Nummer eins. Anlass seiner Reise und der Visite anderer Spitzenbesucher in
Russland ist das 300. Petersburger Stadtjubiläum. Was man in Putins Reich
derzeit formuliert, ist in diesen Tagen immer auch ein Petersburger Manifest.
Das vom Dienstag kann allerdings folgenlos bleiben. Die tatsächlichen
Kräfteverhältnisse werden eher in englischer als in chinesischer oder russischer
Sprache dargestellt. Die Washingtoner Regierung ist in ihrer derzeitigen Hybris
wahrscheinlich nicht gerade bereit, freudig zuzuhören. Doch die Zwischentöne,
die sich aus den Aussagen der beiden Staatsführer einer gewesenen und einer
entstehenden Weltmacht heraushören lassen, gelten den USA. Denen ein politisches
Gegengewicht entgegenzusetzen sind beide entschlossen, auch wenn sie es nur
leise andeuten.
So ist auch Putins Werben um ein mit Russland befreundetes, unabhängiges,
glaubwürdiges und politisch starkes Europa zu verstehen. Die hohen Gäste beim
Festtag in Putins Geburtsstadt werden es zum wiederholten Male hören, ohne lange
nachfragen zu müssen. Es wird, wie schon am Dienstag in Moskau, auch an der Newa
über strategische Partnerschaft geredet werden, über wirtschaftliche und
kulturelle Zusammenarbeit; wenn sich die regierenden Großen dieser Welt aus
solchem Anlass treffen, sind politische Absichtserklärungen und zukunftsweisende
Worte einfach unvermeidlich.
Die politische Praxis ist schwieriger. Bei ihrem Treffen haben Hu und Putin den
Wunsch geäußert, die koreanische Halbinsel möge kernwaffenfrei bleiben,
Nordkorea solle gefälligst auf die Entwicklung solcher Massentötungsinstrumente
verzichten. Die in ihren eigenen (Zwangs-)Vorstellungen befangene Führung in
Pjöngjang schert sich um solche Wünsche jedoch nicht; sie legt es darauf an, die
USA zu ihren Bedingungen an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch ihre
Handlungen sind kontraproduktiv, wie die jüngsten Drohungen gegen Südkorea
belegen.
Bisher ist es niemandem gelungen, Kim Jong Ils ideologischen Beton zu
durchbrechen. Ob russisch-chinesische Bemühungen da etwas ausrichten können,
wird zur Nagelprobe auf ihre Petersburger Zielvorstellungen. Hu und Putin haben
vielleicht doch viel zu viel versprochen.
Frankfurt am Main, 30.05.03
Bei allem, ein Fenster nach Europa
300 Jahre St. Petersburg: Baustelle und Stadt der Zaren, Metropole der Künste und der Wissenschaft, der Revolution und der Despotie
Von Karl Grobe
![]() Weiße
Nächte - dann beleuchtet die Sonne, knapp unter dem Horizont, auch von Norden
her die Millionenstadt an der Newa. In solchen Nächten, an solchen Tagen feierte
die Metropole, die damals Leningrad hieß, unter anderem den Tag der
Sowjetflotte. Die Ostsee-Eskadra war vor Anker gegangen, in ihrer Sichtweite lag
fest vertäut der berühmte Panzerkreuzer "Aurora". Wir sahen vom Dachrestaurant
des Hotels, das den Namen der Stadt trug, auf ihn und die Eskadra hinab. Ein
privilegierter Platz war dies; DDR-Deutsche, mit der falschen Währung versehen,
hatten keinen Zutritt, die Klassengesellschaft war nach harter und weicher
Valuta sortiert. Blinksignale tauschten die Kriegsschiffe aus, und wir fragten
uns, wann endlich die revolutionär befreienden Schüsse aus den Kanonen der
"Aurora" abgefeuert würden. 1917 war das geschehen, das Signal zum Umsturz, den
unendliche Hoffnungen getragen hatten, bis die Stalinsche Realität sie um die
konkrete Utopie betrog. Unser heimlicher Wunsch an den Panzerkreuzer, so
spielerisch er war, blieb in jenem Leningrader Sommer ungehört.
Weiße
Nächte - dann beleuchtet die Sonne, knapp unter dem Horizont, auch von Norden
her die Millionenstadt an der Newa. In solchen Nächten, an solchen Tagen feierte
die Metropole, die damals Leningrad hieß, unter anderem den Tag der
Sowjetflotte. Die Ostsee-Eskadra war vor Anker gegangen, in ihrer Sichtweite lag
fest vertäut der berühmte Panzerkreuzer "Aurora". Wir sahen vom Dachrestaurant
des Hotels, das den Namen der Stadt trug, auf ihn und die Eskadra hinab. Ein
privilegierter Platz war dies; DDR-Deutsche, mit der falschen Währung versehen,
hatten keinen Zutritt, die Klassengesellschaft war nach harter und weicher
Valuta sortiert. Blinksignale tauschten die Kriegsschiffe aus, und wir fragten
uns, wann endlich die revolutionär befreienden Schüsse aus den Kanonen der
"Aurora" abgefeuert würden. 1917 war das geschehen, das Signal zum Umsturz, den
unendliche Hoffnungen getragen hatten, bis die Stalinsche Realität sie um die
konkrete Utopie betrog. Unser heimlicher Wunsch an den Panzerkreuzer, so
spielerisch er war, blieb in jenem Leningrader Sommer ungehört.
Die "Aurora" an Ketten
Die Zeit war die der später so genannten Breschnewschen Stagnation. Die "Aurora"
lag nicht nur an Ketten; sie war im politischen Packeis angefroren. Die schöne
Stadt an der Newa und ihren Kanälen war verrunzelt, nur dort mit ein wenig Farbe
angehübscht, wo Touristen - die mit den richtigen Währungen - sich tummelten.
Die glanzvolle Zeit, da sie Zentrum einer absolutistischen Weltmacht war, fand
nur mehr in den Erinnerungswerten der Architektur statt; die Maßnahmen der
Revolutionäre und der Usurpatoren der Revolution hatten ihr nicht nur die alten
Namen genommen - St. Petersburg, Petrograd -, sondern auch die
Metropolen-Funktion.
Geblieben war das Industriezentrum, das nun längst nicht mehr revolutionäre
Proletariat, und noch waren Teile der großen Hauptstraße, des Newskij Prospekt,
mit demselben Holz gepflastert wie zu Zeiten der Zaren. Geblieben, aber von den
Kriegsnarben gezeichnet, war die architektonische Außenseite, die "Europa" sagte
und es nicht mehr, noch nicht wieder meinen durfte.
Dennoch: Dass diese Stadt lebte, war ein Mirakel. Rund dreißig Jahre vorher
hatte Hitlers Wehrmacht Leningrad eingekesselt, blockiert und 872 Tage lang dem
Hunger und dem Dauerfeuer der Artillerie ausgesetzt. Es war der Tiefpunkt der
Stadtgeschichte, er hätte tödlich sein können und war es für viele. Allein 1942
starben 650 000 Leningrader an der Belagerung, die zu durchbrechen nur im Winter
gelang, über das Eis des Ladoga-Sees, über den eine Million Kinder und Kranke in
die relative Sicherheit des Hinterlands gebracht werden konnten. Und als die
Wehrmacht geschlagen abziehen musste, zerstörte sie noch die Paläste von
Peterhof und Zarskoje Selo, das damals Puschkin hieß. Der Sieg über die
Wehrmacht aber öffnete der Sowjetarmee den Weg nach Berlin und an die Elbe; nach
Mitteleuropa, das so sowjetisch werden sollte wie Stalins Sowjetunion.
Leningrad blieb Leningrad, zweitgrößte Stadt der Union zwar, aber eine Stadt
fern der Metropole Moskau, Provinz also im Grunde. Was wenigstens den Vorteil
hatte, dass ihr die baulichen Scheußlichkeiten des Zuckerbäckerstils weitgehend
erspart blieben. So hielt sich die Physiognomie der Kernstadt, der
Admiralitätsseite, der Petrograder, der Wiburger Seite und der
Wassiljewski-Insel; ein europäisches Gesicht.
Eben dieses Europäische aber ist der Inhalt, den der Gründer-Zar Peter I. dem
Ort hatte geben wollen, als er am 27. Mai 1703 (16. Mai nach altem Kalender) den
Grundstein legen ließ im sumpfigen Gelände, in gerade den Schweden abgewonnenem
Gebiet. Das Fenster nach Europa aufstoßen: Diesen programmatischen Satz erfährt
man mit der ersten Information über die historische Tat. Der Grundstein war
jener der Peter-Pauls-Festung: ein Symbol für die militärische Kraft der
Großmacht in Osteuropa und dafür, dass diese Macht den Zugang zur Ostsee, zu den
Verkehrswegen in den Westen nie wieder preisgeben werde. Zwölf Jahre darauf
dekretierte der Zar, diese Stadt, nicht nach ihm, sondern dem Heiligen auf den
Namen St. Petersburg getauft, sei von nun an die russische Hauptstadt anstelle
Moskaus. Da waren schon die ersten Schiffsneubauten an der Newa vom Stapel
gelaufen; doch erst zwei Jahre nach dem Dekret, Anno 1714, wurde der erste
steinerne Bau der neuen Stadt bezogen, errichtet für ihren ersten Gouverneur,
Fürst Alexander Daniilowitsch Menschikow.
Als Peter I. 1725 starb, war seine Stadt noch eine Baustelle. Unter seinen
Nachfolgern und Nachfolgerinnen, besonders Katharina II., wurde sie zur
glänzenden Metropole. Den Winterpalast plante ab 1754 der italienische
Barock-Baumeister Bartolomeo Rastrelli; er und seine Zeitgenossen Sawwa
Tschewakinskij und Wassilij Stassow entwickelten den farbenfrohen, russischen
Barock mit seiner klaren Linienführung. Das Gebäude, das einst den Generalstab
beherbergte, wurde sechzig Jahre später von Carlo Rossi entworfen.
Auch andere italienische Baumeister haben das Bild der russischen Kaiserstadt
geprägt. Franzosen wie Étienne Falconet, der das bronzene Reiterstandbild Peters
I. entwarf, oder Auguste Montferrand, von dem die gigantische, den Geschmack der
Kritiker in der Mitte des 19. Jahrhunderts überfordernde,
Sankt-Isaaks-Kathedrale stammt, oder Thomas de Thomon, der 1805 die Börse bauen
ließ, formten das Antlitz St. Petersburgs weiter nach dem Bild des europäischen
Westens und Südens.
Russlands Beitrag zur Weltliteratur ist zum großen Teil hier geschrieben worden:
Die Namen Nikolaj Gogol, Alexander Puschkin, Fjodor Dostojewski und Leo Tolstoi
sind die Namen Petersburger Autoren. Dass Peter Tschaikowski, Nikolaj
Rimskij-Korsakow, Sergej Rachmaninow und Dmitri Schostakowitsch zur
(Petersburger) Welt-Musikgeschichte gehören, muss da kaum noch erwähnt werden.
Das russische Ballett (von Marius Petipa bis Sergej Diaghilew, Waslaw Nijinski
George Balanchine und Anna Pawlowa), die Wissenschaft von Michail Lomonossow
über Dimitri Mendelejew bis Iwan Pawlow, Wladimir Bechterew und Pitirim Sorokin
(Russlands erster Soziologe, der nach der Revolution freilich in die USA
emigrierte) waren in St. Petersburg daheim.
Die Hochblüte der Kaiserstadt an der Newa zog sehr intensiven Austausch mit dem
Ausland nach sich; zahllose deutsche Wissenschaftler haben sich seit Katharinas
II. Zeit in St. Petersburg aufgehalten, geforscht und publiziert, Deutsch war
jahrzehntelang die erste Wissenschaftssprache im Russischen Reich. Eine
Marginalie vielleicht nur ist, dass der spätere Eiserne Kanzler der Deutschen,
Otto von Bismarck, seine politische Karriere als Botschafter am russischen Hof
begann.
Das charakterisiert die glänzende Seite absolutistisch regierter Staaten, dass
ihre Metropolen zu Zentren des kulturellen Lebens werden. Dort ist die
leisure class konzentriert, die Klasse der nicht Arbeitenden, die Mäzene
sein können und dazu auch von ihren obersten Dienstherren angehalten werden;
dort ist auch das Publikum, das sich an den Entwicklungen in der großen weiten
Welt beteiligt. Sankt Petersburg war weltoffen in einem rückständig gebliebenen
Land; es war Ausdruck der russischen Möglichkeiten und zugleich der russischen
Realität sehr fern.
Die Distanz ging quer durch die Stadt. Von 1864 bis 1900 wuchs die Bevölkerung
von einer halben auf anderthalb Millionen; die Zugewanderten waren nicht nur
Großbesitzer im fernen Hinterland, sie waren meist Proletarier, konzentriert in
den Riesenbetrieben der Rüstungsindustrie und der zivilen Produktion, arm und
elend in der glanzvollen Stadt. Das war die revolutionäre Kraft, die 1917 das
vom Volk so weit entfernte Regime stürzte; das waren die Anhänger Lenins,
Trotzkis, Kamenjews, Sinowjews - ja, und Stalins. Der liquidierte seine
Kampfgenossen, der wurde Diktator in Moskau.
Der europäische Aspekt Leningrads
Der europäische Aspekt Leningrads - so hieß die Stadt seit 1924, dem Todesjahr
des Revolutionsführers - war unter Stalin zur Potemkinschen Fassade verfallen.
Äußerlich nach dem Kriege repariert und restauriert, war Leningrad ein Platz der
landesüblichen Repression geworden. Nach dem wahrscheinlich bestellten Mord an
Stalins Rivalen von der Newa, Sergej Kirow, begann die Vernichtung der
Kommunisten durch die Geheimpolizei des Kommunisten Stalin; die letzte Reprise
seiner zerstörerischen Politik war die "Leningrader Affäre" von 1952. Das
politische Tauwetter entstand im Moskauer Klima. Leningrad war peripher
geworden; doch in Leningrad nahm, inspiriert durch den Juristen und Demokraten
Anatolij Sobtschak, die Wende Tempo auf, als in der Zentrale Michail Gorbatschow
zu schwanken begann zwischen Veränderern und Orthodoxen, denen er zu sehr
vertraute.
Die Tempi der Veränderung und der Verlangsamung werden noch immer in Moskau
vorgegeben. Doch dort bestimmt einer aus der Newa-Stadt, Wladimir Putin, auf
seine Art. Er empfing die großen der Welt dieser Tage in der Stadt, in der er
seinen ersten geheimdienstlichen Beruf erlernt hat. Das ist Geschichte; die hat
sich beschleunigt zu Ansätzen der Demokratie.
Und die
"Aurora" hat nie wieder geschossen.
![]()
30-5-2003
Ich bin Pantelejew, gebt mir die Mäuse
Seit eineinhalb Jahrhunderten wurde die Petersburger Bastille, das „Kresty“ nicht renoviert
Von Ilja Stogof
Die Regierung Russlands hat für die Vorbereitung des 300. Geburtstags Petersburgs fast 500 Millionen Dollar ausgegeben. Das Geld wurde vernünftig angelegt. In zwei Jahren wurden zweihundert Schlösser, Villen, Kirchen und Häuser im Zentrum restauriert. Aber für die Renovierung des zentralen städtischen Gefängnisses, des „Kresty“ (Kreuze), hat das Geld wieder nicht gelangt. Seit fast eineinhalb Jahrhunderten wurde die „Petersburger Bastille“ nicht renoviert.
Die ersten Gefangenen wurden 1876 ins „Kresty“ gebracht, und seitdem hat sich nichts verändert. Die einzige Neuerung in den fünfziger Jahren war eine Reparatur in den Toilettenräumen. Das Geld dafür hatte ein Mitarbeiter des sowjetischen Raumfahrtprogrammes, Sergej Koroljow, aufgebracht. Seinerzeit hatte Koroljow aus politischen Gründen gesessen und unter dem Geruch der Exkremente gelitten. Als er später den Stalinpreis bekommen hatte, überwies er ohne zu zögern die Kohle für diese vornehme Sache.
„Kresty“ liegt mitten im Zentrum Petersburgs, ein riesiges Ziegelgebäude direkt am Ufer der Newa. Vor der Feier zum Geburtstag wurde die Stadt gereinigt und mit Plakaten geschmückt. Nur um das „Kresty“ liegen wie immer Müllhaufen und gigantische, chemieverseuchte Brachen. Vor zweihundert Jahren war dies der Friedhof vor der Stadt. Um den Platz für den Bau des Gefängnisses zu reinigen, wurde er abgetragen. Bis heute stößt man auf alte Grabsteine, die Todesdaten in der alten Zeitrechnung tragen. Ohnehin nennt das Volk diesen Ort „Wolfsboden“. In kalten Wintern fror der Boden hart wie Stein. Die Toten bestattete man, indem man sie einfach mit Erde oder Schnee zudeckte. Die Wölfe liefen in Rudeln auf den Friedhof und fraßen die Leichen. Sie griffen sogar die Lebenden an.
Wenn sich damals jemand in dieser Gegend, der südlichen Bronx, niederließ, dann nur Gesindel. Nachts traute sich die Polizei nicht auf den Friedhof. Einige Plätze wagte sie auch tagsüber nicht zu betreten. Es galt als Ehre, einem Polizisten einen Sack über den Kopf zu ziehen und ihn totzutreten. Ist es erstaunlich, dass das erste steinerne Gebäude des ganzen Bezirkes das finstere und imposante „Kresty“ wurde?
Der innere Aufbau des Gefängnisses ist bis heute ein Staatsgeheimnis. Man kennt nicht einmal die genaue Zahl der Zellen. Den Gerüchten nach sind es 599, und in der 600. wurde der Architekt nach dem Bau lebendig eingemauert, so dass er das Geheimnis der verwirrenden Gefängnisarchitektur mit ins Grab nahm. Ob das stimmt, weiß niemand. Möglicherweise ist es nur ein urbanes Gerücht. Ganz sicher ist dagegen: Als Arbeiter 1964 das Büro des Direktors der Untersuchungseinheit renovierten, entdeckten sie unter den Bodenfliesen acht menschliche Skelette ohne Kopf, akkurat in einer Reihe, in Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Nach dem normativen Fassungsvermögen passen 3300 Menschen ins „Kresty“. Heute sitzen hier mit 9862 Gefangenen dreimal so Menschen. Die Häftlinge schlafen in drei Schichten. Einige können sich eine ganze Woche lang nicht ausstrecken. Es versteht sich von selbst, dass die Insassen nur von einem träumen: Freiheit. Trotzdem ist es bis jetzt nur einem Menschen gelungen zu fliehen, dem legendären Banditen aus den zwanziger Jahren, Lenka Pantelejew.
Nach dem normativen Fassungsvermögen passen 3300 Menschen ins „Kresty“. Heute sitzen hier mit 9862 Gefangenen dreimal so Menschen. Die Häftlinge schlafen in drei Schichten. Einige können sich eine ganze Woche lang nicht ausstrecken. Es versteht sich von selbst, dass die Insassen nur von einem träumen: Freiheit. Trotzdem ist es bis jetzt nur einem Menschen gelungen zu fliehen, dem legendären Banditen aus den zwanziger Jahren, Lenka Pantelejew.
Pantelejew war so berühmt, dass er einen Bürger ohne Waffen ausrauben konnte. Der Satz: „Ich bin Pantelejew, gebt mir die Mäuse“ wirkte wie ein tödlicher Revolver. Nach nur einem Jahr seiner Karriere war Pantelejew einer der reichsten Leute in der Sowjetunion. Dann geschah Lenka etwas Dummes. Im Herbst 1922 betrat er ein Geschäft, um sich eine Lederjacke zu kaufen. Dabei wurde er von einem Milizionär erkannt und in der Umkleidekabine festgenommen. Der Prozess begann am nächsten Tag. Zum Abendessen war das Urteil fertig. Pantelejew überließ man das letzte Wort: „Man will mich erschießen. Aber ich werde ausbrechen.“Die achtzehn Milizionäre, die Pantelejew rund um die Uhr bewachten, lachten laut. Schon vierundzwanzig Stunden später war seine Zelle leer. Wie er das geschafft hat, hat nie jemand erfahren. Noch zwei Jahre nach der Flucht beraubte und ermordete Pantelejew die Bürger Petersburgs. Nachdem sie ihn endlich eingefangen und erschossen hatten, amputierten sie seinen Kopf, legten ihn in Alkohol ein und stellten ihn in der Vitrine des Delikatessengeschäftes Jelissejew auf dem Newskij aus, der wichtigsten Straße der Stadt.
Auch nach Pantelejew versuchten viele, aus dem „Kresty“ zu flüchten. Aber vergebens. Der bekannteste Ausbrecher war Sergej Madujew, der letzte Robin Hood unter den russischen Kriminellen. Madujew, bekannt unter dem Namen „Tscherwonez“, der Zehnrubelschein, war der Sohn einer Tschetschenin und eines Koreaners. Er wurde im Gefängnis geboren. Als Jugendlichen verurteilten sie ihn wegen Banditentums zu 15 Jahren. Nachdem er die Hälfte abgesessen hatte, brach er aus und lebte ein lockeres Leben.
Die Verfolger zählten später 60 Vorfälle und vier Leichen. Sie schnappten ihn im Januar 1990. Doch als er scheinbar entwaffnet und mit Handschellen an einen Milizionär gefesselt war, riss er unter dem Jackett eine Granate hervor und erklärte, er werde die gesamte Gruppe als Geiseln nehmen. Daraufhin schossen sie ihm in die Hand, schleuderten die Granate durch die Tür und brachten ihn ins „Kresty“. Im ersten Gespräch mit dem Gefängnisdirektor sagte Tschernowez: „Ich werde hier verschwinden.“ Man beauftragte die junge Untersuchungsrichterin Natalja Woronzowa, sich mit Madujews schwieriger Biographie zu beschäftigen. Dann geschah das Unmögliche. Die Geschichte ist längst zur Legende geworden, sogar ein Film wurde danach gedreht, „Gefängnis-Roman“: Der tschetschenische Draufgänger bezauberte die junge Untersuchungsrichterin und überredete sie, ihm bei der Flucht zu helfen. Die Woronzowa stahl Madujew seinen eigenen Trommelrevolver aus dem Safe der Staatsanwaltschaft, dazu 16 Patronen und eine dunkle Sonnenbrille, die er sich gewünscht hatte.
Am 3. Mai 1991 führten sie Madujew zum Ausgang. Auf dem Korridor zog er plötzlich einen Revolver, schoss in die Luft und befahl der Eskorte, sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen. Der Major stürzte sich auf ihn und bekam eine Kugel in den Bauch. Dem anderen Major drückte er die Mündung in den Rücken und befahl, ihn auf den Hof zu bringen. Madujew hatte keine Chance. Als er auf den Hof trat, waren die Maschinengewehrschützen schon da. Nach zwei Schusswechseln war sein Magazin leer. Der Ausbrecher ergab sich.
Natalja Woronzowa bekam sieben Jahre. Das Ärgerlichste aber war, dass Madujew gleich nach ihrer Festnahme in einem Interview erklärte, seine einzige Liebe sei stets Tamara M. gewesen, eine Zeugin. So erwies sich die Tätowierung Madujews für die Woronzowa als wahr: „Liebst Du mich, stirbst Du für mich.“ Danach versuchte Madujew noch zweimal zu fliehen. Er grub einen Tunnel, schoss auf eine Eskorte, aber entkommen konnte er nicht. Das Gericht verurteilte Madujew zum Tod durch Erschießen. Das Urteil wurde nie vollstreckt, denn inzwischen war ein Moratorium über die Todesstrafe verhängt worden. Einige Zeit verbrachte Tscherwonez in Nowotscherkask, in einem Gefängnis für Lebenslängliche, danach brachte man ihn nach Orenburg. Dort starb er mit 44 Jahren unter ungeklärten Umständen. Einen Tag später entließ man Natalja Worozowa.
Möglicherweise geht bei den Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag eine früh gealterte, einsame Frau unter den vergitterten Fenstern von „Kresty“ spazieren, einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die man den Touristen niemals zeigen wird.
Der Autor, Jahrgang 1970, ist Journalist und Schriftsteller und lebt in Sankt Petersburg. Im Herbst erscheint mit „Machos weinen nicht“ (Droemer) sein erstes Buch in Deutschland.
Deutsch von Sonja Zekri
|